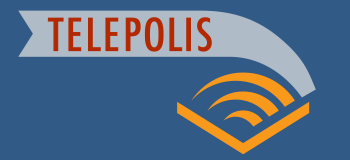Lesen als Luxus: Wenn nur noch Rebellen Originale wertschätzen

KI-generierte Grafik
In einer Welt, in der KI Texte schneller und effizienter verarbeitet als Menschen, wird das Lesen von Originalen zum bewussten Statement.
Weil so viele, egal, ob nur gefühlt oder tatsächlich faktisch, wenig Zeit haben, wird sie nach neuen Vorgaben neu organisiert. So kann man jetzt beim Lesen von News gut Zeit sparen, wenn es um den nützlichen, sofort brauchbaren Kern einer Information geht.
Seit Google KI-generierte Zusammenfassungen ("AI Overviews") ganz oben in den Suchergebnissen anzeigt – noch vor den Links zu den Originalquellen, enden inzwischen rund 60 Prozent aller Google-Suchen ohne einen Klick auf einen externen Link. Studien zeigen laut, "dass KI-Übersichten die Klickrate um 30 bis 70 Prozent senken" (SRF).
Das Original wird häufig nicht mehr gelesen, klagen Verleger.
Lesen Sie auch
KI und Lesen: Wer liest noch das Original?
Die Ära der Antwortmaschinen
Auf eine fatale Pointe gebracht, bedeutet dies, wie es Thore Rausch in der SZ formuliert, läuft dies auf eine dramatische Wende hinaus: Google mutiert von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine. Kein Wunder, dass die Verleger eine existenzielle Bedrohung wittern
Was zunächst wie eine Bonusoption am oberen Bildschirmrand aussieht, wirft die Logik, wie das Internet funktioniert, gründlich durcheinander. Denn wer braucht noch Medien, wenn Google es selbst ohnehin besser wissen will?
Thore Rausch,SZ
Medienhäuser sehen das so: Sie investieren in redaktionelle Inhalte, verlieren aber Sichtbarkeit, Reichweite und damit Werbeeinnahmen. Die Washington Post etwa verzeichnet seit dem Aufkommen von Googles KI und ChatGPT einen drastischen Rückgang an Zugriffen über Suchmaschinen.
Bis dato gilt das Dogma: Wer nicht möchte, dass eigene Inhalte von Googles KI "ausgelesen" werden, muss den Ausschluss aus der Suchmaschine in Kauf nehmen – bei über 90 Prozent Marktanteil von Google ist das wirtschaftlich kaum überlebbar.
Das Dilemma
Medien befinden sich in einem Dilemma: Einerseits profitieren sie von der Sichtbarkeit, die Google und andere Plattformen bieten. Andererseits verlieren sie zunehmend die Kontrolle über den Zugang zu ihren Inhalten. Der digitale Journalismus droht, Rohstofflieferant für maschinelle Textverarbeitung zu werden – ohne faire Beteiligung.
Doch diese wirtschaftliche Verdrängung ist ein Teil einer größeren Geschichte. Was auf dem Spiel steht, ist viel grundlegender: nämlich die Lesekultur selbst. Das große Feld kann hier nicht abgesteckt werden. Daher nur eine Stichprobe und ein paar grundsätzliche Linien.
Was ist Lesekultur? Worauf kommt es an?
So macht etwa die kanadische Autorin Anne Carson, die als Professorin für Altertumswissenschaften gearbeitet hat und klassisches Griechisch unterrichtet und übersetzt hat, auf einen interessanten Zusammenhang zwischen Übersetzen und Denken aufmerksam.
Das Zögern, das man lange Zeit erlebte, bis man eine passende Übersetzung für ein unbekanntes Wort in einem fremdsprachigen Text fand, weil man vom Wörterbuch nur ein Wortfeld bekam, statt eines übersetzten Einzelworts, wie es die schnelle Maschine jetzt erledigt, sei für die Lektüre selbst sehr nützlich, weil es die Reflexion über den Text vertieft.
Das mag wie eine etwas elitäre, hochnäsige professorale Haltung erscheinen, wenn man allerdings für eine Lesekultur zur Geltung bringt, wie sehr langsames Lesen Vorgestanztes entzaubert und Klischees in Bewegung bringen kann, dass Nuancen sehr wichtig sind (wie auch in menschlichen Beziehungen) – dann ist die Lesekultur via schneller Lektüre von schnellen KI-Texten auf einem anderen Pfad. Dem, der Klischees verstärken könnte.
Überspitzt gesagt: Die KI arbeitet mit den Wahrscheinlichkeiten, gegen die Autoren kämpfen: Floskeln, die einem arg schnell in die Finger kommen, dazu kommen Denkstandards. Doch so einfach ist es nicht.
KI kann aufgrund seiner Dynamik und der Rückkopplungen mit klugen Texten mehr. So führt der Wandel, den die Art, wie wir lesen, gerade erfährt, nicht durch einen derart einfachen Wahrnehmungstunnel.
Die Frage, was mit dem Lesen passiert, wenn Maschinen es schneller, umfassender und scheinbar effizienter können als Menschen, ist nicht auf einen einfachen Nenner zu bringen.
KI als Super-Leser
Der Blick auf die Künstliche Intelligenz führt weiter als zur ökonomischen Schieflage der Medien. Der amerikanische Autor Joshua Rothman liefert in seinem Artikel "What’s Happening to Reading?" – Was passiert mit dem Lesen? – im Magazin The New Yorker ein paar bemerkenswerte Akzente
Große Sprachmodelle wie etwa ChatGPT sind im Grunde Super-Lesemaschinen, argumentiert er. Sie haben Abermillionen Texte verarbeitet, erkennen Muster, fassen zusammen, vergleichen, paraphrasieren – oft mit mehr Effizienz als ein menschlicher Leser.
Sie bieten Zusammenfassungen, Übersetzungen, Varianten und sogar neue Darstellungsformen – vom Podcast über das Abstract bis zur kommentierten Version. Für Nutzer heißt das: Man muss den Text nicht mehr selbst lesen, um "Bescheid zu wissen".
Das "Original" wird optional
Rothman beschreibt eine Zukunft, in der Texte zunehmend als formbare, fließende Rohstoffe betrachtet werden. Lesen heißt dann nicht mehr, sich einem Werk linear und konzentriert zu widmen, sondern es zu verwerten, zu transformieren, weiterzuleiten.
Das "Original" wird optional – eine Entscheidung, die bewusste Tiefe voraussetzt, nicht mehr Normalität.
Lesen Sie auch
Was heißt "Belesen sein" jetzt?
Die Konsequenzen sind tiefgreifend: "Belesen" zu sein verliert seinen Status als kulturelle Auszeichnung. Wer Zusammenfassungen nutzt, mit KI über Inhalte diskutiert oder komplexe Literatur auf einfache Sprache "herunterbrechen" lässt, kann sich ebenfalls als informiert fühlen.
Es wird schwerer zu unterscheiden, wer wirklich gelesen hat – und ob das überhaupt noch zählt.
Neue Strategien von Autoren
Auch das Schreiben verändert sich: Manche Autorinnen und Autoren beginnen bereits "für die KI" zu schreiben, wie der Ökonom Tyler Cowen. Texte werden so gestaltet, dass sie für Maschinen leicht verarbeitbar sind.
Andere wiederum versuchen, durch stilistische Komplexität oder persönliche Stimme gezielt menschliche Leser anzusprechen – als Widerstand gegen automatisiertes Lesen. Möglicherweise entstehen neue literarische Strategien, die sich dem Zugriff der Maschinen entziehen.
Eine neue Remix-Kultur
Diese Entwicklungen führen nicht zwangsläufig zu einem Niedergang des Lesens – aber zu seiner Transformation. Lesen wird fragmentarischer, intermediärer, anwendungsbezogener. Der Text als abgeschlossene Einheit verliert an Bedeutung.
Stattdessen tritt eine "Remix-Kultur des Lesens" in den Vordergrund: Ein Text ist nicht mehr Ziel, sondern Ausgangspunkt – ein Sprungbrett zu etwas anderem.
Kompensation: KI als Gedächtnisprothesen
Das betrifft auch das Gedächtnis. Während menschliche Leser mit Vergessen kämpfen, könnten KI-gestützte Leseassistenten als Gedächtnisprothesen dienen – sich Texte merken, Kontexte liefern, Querverbindungen herstellen. Doch damit bleibt offen, was aus der emotionalen, kontemplativen und sozialen Dimension des Lesens wird – der Fähigkeit, sich in einem Text zu verlieren, berührt zu werden, gemeinsam zu lesen.
Denn so präzise und allwissend KI auch sein mag: Sie liest nicht aus Interesse, sie liebt nicht, sie vergisst nicht – aber sie versteht auch nicht auf menschliche Weise. Ihre Leistung liegt in der Tiefe des Datenraums, nicht im Erlebnis.
Lesen als kulturelles Statement
Die Zukunft des Lesens würde demnach weder rein dystopisch noch rein optimistisch sein.
KI bedroht die ökonomischen Grundlagen traditioneller Medien, das ist real und akut. Gleichzeitig eröffnet sie neue Wege des Zugangs, der Verständigung und der Verarbeitung von Texten.
Was bleibt, ist die Notwendigkeit, neue Kriterien für Tiefe, Bildung und Textkompetenz zu entwickeln. In einer Welt, in der Maschinen Texte besser "kennen", wird das menschliche Lesen nicht verschwinden – aber es wird seltener, bewusster und vielleicht bedeutungsvoller.
Denn wer sich dafür entscheidet, das Original zu lesen, tut es nicht mehr aus Notwendigkeit – sondern aus Wahl. Und diese Wahl wird zu einem kulturellen Statement.