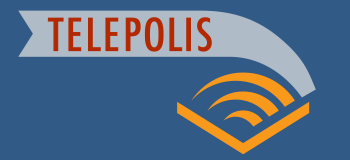KI und Lesen: Wer liest noch das Original?

KI-generierte Grafik
Googles AI Overviews beantworten Fragen – bevor sie jemand stellt. Verleger klagen, dass sie dadurch Leser und Geld verlieren. Wie stehen ihre Chancen?
In einer für Normalbürger schwer durchschaubaren Materie, der juristischen Auseinandersetzung zwischen Urheberinteressen, Geschäftsinteressen und dem gigantischen Lese- und Textverwertungsapparat mit dem Sammelnamen KI, rollen erste Klage-Wellen heran.
Größere Aufmerksamkeit über Fachkreise hinaus erzielen die Urteile zweier US-Gerichte, die sich mit der Frage des KI-Trainings mit urheberrechtlich geschützten Büchern befassten.
Zwischen Fair Use und Marktverdrängung: Erste Urteile, viele offene Fragen
"Es ist ein juristischer Richtungsstreit mit Signalwirkung", ordnet Netzpolitik.org die Entscheidungen in einem Artikel ein, den sie mit der Frage "Darf KI mit Raubkopien trainieren?" einleitet.
Die Überschrift lautet zwar "KI darf weiter Bücher lesen", aus dem nuanciert verfassten Text geht jedoch hervor, dass es interessante Unterschiede in den Urteilen gibt.
Während das Gericht in einem Fall betonte, dass KI-Modelle hochgradig transformativ seien und nicht direkt mit Originalwerken konkurrierten, erkannte der andere Richter, in einem Verfahren gegen Meta, durchaus eine mögliche Marktverdrängung. Allerdings sah er die Argumentation der klagenden Autorinnen und Autoren als zu schwach belegt.
Trotz der formalen Zustimmung zum Training mit urheberrechtlich geschütztem Material zeigt sich hier eine bemerkenswerte juristische Differenzierung in der Bewertung von Marktwirkungen und Transformation, die auf künftige Verfahren ausstrahlen dürfte.
Die Debatte ist damit nicht abgeschlossen. Zwar liefert auch das US Copyright Office eine tendenzielle Zustimmung zur Fair-Use-Nutzung bei ausreichend starker Transformation, betont jedoch, dass Inhalte aus piratisierten Quellen nicht darunterfallen.
Lesen Sie auch
KI darf trainieren – doch wer schützt die Autoren?
In Europa – speziell in Deutschland – ist die Rechtslage durch §44b UrhG spezifischer geregelt, wie netzpolitik ausführt: KI-Training ist auch kommerziell erlaubt, setzt aber eine spätere Löschung der genutzten Werke voraus und erlaubt den Autoren ein Opt-out.
Die Frage, ob durch KI erzeugte Inhalte die wirtschaftlichen Grundlagen von Urhebern gefährden, bleibt dabei zentral – ebenso wie die künftige gerichtliche Bewertung solcher Risiken.
Die letzten beiden Sätze des Artikels unterstreichen, dass sich ein rechtlich gefestigter Rahmen für das KI-Training mit urheberrechtlich geschützten Inhalten erst noch herausbilden muss.
Wenn eine KI also nach dem Training in der Lage sei, beispielsweise Fortsetzungen zu Büchern zu schreiben, dann entstünde eine Bedrohung für die Verwertungs- und Existenzgrundlagen der Urheber, die vor Gericht bewertet werden muss.
Genauere Auslegungen dieser Einsprüche werden sich in kommenden Urteilen zeigen. Bis jetzt gibt es noch kein aussagekräftiges Urteil, welches eine Einschätzung der zukünftigen Auslegung der Rechtslage möglich macht.
Netzpolitik.org
Urteile im Land, wo die allermeisten großen Tech-Unternehmen sitzen, sind wichtiger als Urteile in London, kommentiert dazu das aktuelle MDR-Altpapier.
Aus London wird nämlich eine Beschwerde von Verlegern gegen Goole in der Sache Machtmissbrauch durch KI gemeldet (Reuters, FAZ und Standard).
Verlage wehren sich gegen Googles KI-Strategie
Eine Gruppe unabhängiger Verleger, die sich in der "Independent Publishers Alliance" zusammengeschlossen haben, hat bei der EU-Kommission eine Kartellbeschwerde gegen Google eingereicht.
Im Kern werfen die Verleger dem Suchmaschinenriesen vor, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen. Konkret geht es um die sogenannten "AI Overviews" – KI-generierte Zusammenfassungen, die Google seit einiger Zeit ganz oben in den Suchergebnissen anzeigt, noch vor den Links zu den Originalquellen. Diese Funktion ist laut Google bereits in über 100 Ländern verfügbar.
Die Beschwerdeführer argumentieren, dass Google für seine KI-Übersichten Inhalte von Nachrichtenseiten und anderen Webpublishern nutzt, ohne diese angemessen zu beteiligen. Durch die prominente Platzierung der Zusammenfassungen würden viele Nutzer gar nicht mehr auf die Originalartikel klicken. Das führe zu erheblichen Traffic-, Leser- und Einnahmeverlusten für die Verlage, so der Vorwurf.
Verschärfend komme hinzu, dass die Publisher kaum eine Wahl hätten: Entweder sie akzeptieren, dass Google ihre Inhalte für das Training seiner KI-Modelle und die Erstellung der Zusammenfassungen verwendet. Oder sie verzichten ganz darauf, in den Google-Suchergebnissen zu erscheinen – was einem Ausschluss vom Markt gleichkäme.
Die Allianz fordert daher von der EU-Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, um "nicht wiedergutzumachende Schäden" abzuwenden. Konkret verlangen die Verlage die Möglichkeit, ihre Inhalte von der Nutzung durch Googles KI auszuschließen, ohne Nachteile bei der Auffindbarkeit in der Suche befürchten zu müssen.
Unterstützt wird die Beschwerde vom "Movement for an Open Web", in der sich digitale Werbetreibende und Verleger zusammengeschlossen haben, sowie von der britischen Organisation "Foxglove", die sich für Fairness in der Tech-Branche einsetzt.
Neben der Beschwerde in Brüssel haben die drei Organisationen eine ähnliche Klage auch bei der britischen Wettbewerbsbehörde eingereicht.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externer Inhalt geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Der Druck der Plattformmacht
Google weist die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher erklärte, die KI-Übersichten würden es den Nutzern ermöglichen, "noch mehr Fragen zu stellen". Das schaffe "neue Möglichkeiten, Inhalte und Unternehmen zu entdecken".
"Darin, Kritik mit schwafeligem Nonsense abperlen zu lassen, besitzt der Google-Konzern Routine", kommentiert MDR-Altpapier-Autor Christian Bartels:
Das schaffe halt "neue Chancen für Inhalte und Unternehmen, entdeckt zu werden", lautet er in diesem Fall, und motiviere "Menschen, mehr Fragen zu stellen". Noch mehr zu googeln, dürfte das in der Logik des kalifornischen Datenkraken heißen.
Ob die Beschwerde der Verleger aus kartellrechtlicher Sicht Erfolg haben wird, ist noch völlig offen. Die EU-Kommission muss nun prüfen, ob sie ein formelles Verfahren gegen Google eröffnet. Der Konzern könnte dann zu Zugeständnissen gezwungen werden – oder im Extremfall Strafen in Milliardenhöhe drohen.
Nicht ausgeschlossen, dass die Verleger und der Suchmaschinen-Konzern aber eine Teile-und-herrsche-Lösung finden, wie im Fall Google News Showcase, wo ein Deal vereinbart wurde, den die Verleger offenbar gerne angenommen haben.