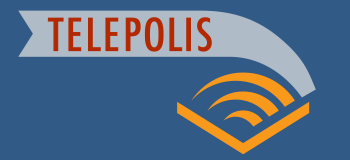Agri-PV könnte Energiebedarf Deutschlands decken

Kernobst, wie Äpfel, profitiert besonders von der Schutzwirkung durch Photovoltaik-Module, die hier Hagelschutznetze ersetzen.
(Bild: Fraunhofer ISE)
Agri-PV kann Strom und Nahrung zugleich liefern – und könnte Deutschlands Energiebedarf sogar übertreffen. Doch es gibt Hürden. Wie groß ist das echte Potenzial?
Agri-Photovoltaik, kurz Agri-PV, ermöglicht eine effiziente Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen: Gleichzeitig können Nahrungsmittel angebaut und Solarstrom erzeugt werden. Eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE zeigt nun, dass Agri-PV ein enormes Potenzial bietet, um den Energiebedarf in Deutschland zu decken.
"Es ist die erste Studie in Deutschland, die für die Identifikation geeigneter Standorte alle Arten landwirtschaftlicher Flächen betrachtet, also Dauergrünland, Ackerfläche und Dauerkulturen wie Obstbau, Wein oder Beeren", erklärt Studienautorin Salome Hauger.
Drei Szenarien zeigen Agri-PV-Potenzial auf
Die Forscher analysierten das Agri-PV-Potenzial in drei verschiedenen Szenarien. Dabei berücksichtigten sie geografische Faktoren sowie rechtliche und behördliche Anforderungen:
- Szenario 1 ("harte Restriktionen"): Schließt Flächen aus, die wegen harter Restriktionen wie Naturschutzgebieten wegfallen. Ergebnis: 7900 Gigawatt Peak (GWp) installierbare PV-Kapazität auf 91 Prozent der Flächen.
- Szenario 2 ("weiche Restriktionen"): Zusätzlicher Ausschluss von Flächen mit weichen Restriktionen wie Landschaftsschutzgebieten. Ergebnis: 5600 GWp Potenzial auf 64 Prozent der Flächen.
- Synergiepotenzial: Fokus auf Flächen mit hoher Synergie zwischen PV und Pflanzen, z. B. Obst- und Weinbau. Ergebnis: 136 GWp (Szenario 1) und 98 GWp (Szenario 2) Potenzial.
Zum Vergleich: Deutschlands PV-Ausbauziel für 2030 liegt bei 215 GWp. Selbst unter konservativen Annahmen wäre also ein Vielfaches davon durch Agri-PV möglich.
Um die am besten geeigneten Flächen zu identifizieren, definierten die Forscher sieben Eignungskriterien. Dazu gehören u. a. die Nähe zu Netzanschlusspunkten, die Geländeneigung, die solare Einstrahlung und die Vereinbarkeit mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
"Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Rolle des Netzausbaus: Das Fehlen von Netzanschlusspunkten ist für viele Flächen ein einschränkender Faktor", betont Hauger.
Lesen Sie auch
Agri-PV als Baustein der Energiewende
Rein rechnerisch könnte Agri-PV also den Strombedarf Deutschlands decken. Doch die Forscher betonen, dass das Potenzial in der Praxis durch weitere Faktoren begrenzt wird, etwa durch rechtliche Hürden, die soziale Akzeptanz oder Investitionskosten.
Ihr Fazit: Agri-PV wird eher als wichtiger Bestandteil eines vielfältigen Energiesystems gesehen – mit großem Potenzial für eine nachhaltige, flächenschonende Energiewende. Anna Heimsath vom Fraunhofer ISE erklärt:
Diese Studien liefern eine solide Datengrundlage für politische Entscheidungsträger und Interessengruppen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern und zur Erreichung der Klimaziele beizutragen.