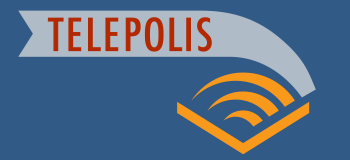Welche Gefahr droht vom Methan?
Die Energie- und Klimawochenschau: Von Exporten, Strafzöllen und arktischen Zeitbomben
Wie immer gibt es diese Woche mehr Neuigkeiten und Entwicklungen aus Klimaforschung und Energiepolitik zu berichten, als auf dem begrenzten Raum unseres wöchentlichen Überblicks unterzubringen ist. Britische Forscher haben sich Gedanken über die großen Methanlagerstätten unter dem Boden des arktischen Schelfmeeres gemacht, ihre deutschen Kollegen haben vor der pakistanischen Küste Hinweise auf einen Methanausbruch in Folge eines Erdbebens gefunden, die Nachrichtenagentur Reuters findet den Klimawandel nicht mehr so wichtig, in den Niederlanden wird an Energiedrachen gebastelt, die vielleicht einmal den Windrädern den Rang ablaufen könnten, Lobbyisten wollen uns mal wieder erzählen, dass es mit dem Klimawandel doch nicht so schlimm ist, und die konzertierte Kampagne gegen das EEG geht weiter. Und dann ist da natürlich noch das große Tohuwabohu beim Braunkohleverstromer Vattenfall, der seinen Konzern umstrukturieren und - wie Greenpeace mutmaßt - eventuell aus dem Geschäft in Deutschland aussteigen will.
Über die Beilegung des Solarstreits der EU mit China hatten wir ja bereits berichtet und auch angedeutet, dass hiesige Hersteller mit dem gefundenen Kompromiss unzufrieden sein werden und klagen könnten, was sich inzwischen bestätigte. Nachgeholt sei hier noch eine Betrachtung des Frauenhofer-Instituts für Solare Energiesysteme. In einer aktuellen Sammlung von Daten und Argumenten rund um die Fotovoltaik (Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland) verweist Institutsmitarbeiter Harry Wirth darauf, dass deutsche Hersteller von Wechselrichtern und Anlagen für die Solarmodulproduktion zum Teil erheblich mehr im Ausland als im Inland absetzen, also auch von der Solarförderung andernorts profitieren. Und er rechnet vor, was die Modul-Importe aus China für die hiesige Wertschöpfung bedeuten:
Trotz der hohen Importquote bei PV-Modulen bleibt ein großer Teil der mit einem PV-Kraftwerk verbundenen Wertschöpfung im Land. Wenn man annimmt, dass 80% der hier installierten PV-Module aus Asien kommen, diese Module ca. 60% der Kosten eines PV-Kraftwerks ausmachen (Rest v.a. Wechselrichter und Installation) und die Kraftwerkskosten ca. 60% der Stromgestehungskosten ausmachen (Rest: Kapitalkosten), dann fließen über die Modulimporte knapp 30% der Einspeisevergütung nach Asien. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass ca. die Hälfte der asiatischen PV-Produktion auf Anlagen aus Deutschland gefertigt wurde.
Harry Wirth, Frauenhofer ISE
Mit anderen Worten, die ganze Auseinandersetzung um die Preise der chinesischen Solarmodule ist für alle außer die hiesigen Modulhersteller ziemlich kontraproduktiv. Wäre der Streit weiter eskaliert, hätten mit einiger Sicherheit nicht nur das mit der Installation befasste Handwerk, sondern auch die Exporteure von Wechselrichtern und Fertigungsanlagen das Nachsehen gehabt. Oder vielleicht auch Unternehmen wie Mounting Systems aus Brandenburg, das im großen Stil PV-Montagesysteme nach Asien exportiert. Volkswirtschaftlich gesehen wären die Strafzölle also eher ein Schuss in den eigenen Fuß und dem raschen Ausbau der Solarenergienutzung haben ihre Befürworter ohnehin einen Bärendienst erteilt.
Aber wenden wir uns von unserer langen Themenliste ab und dem Methan zu. Wir haben hier auf Telepolis schon vor Jahren bereits mehrfach darüber berichtet (Gashydrate tauen auf, Anzeichen für Rückkopplung, Löcher im Permafrost), welche enormen Reservoirs an Treibhausgasen im hohen Norden schlummern.
Zum einen ist der Permafrostboden Sibiriens und Nordamerikas reich an unverwesten Kadavern und Pflanzenresten, die im Falle ihres Auftauens von Bakterien zersetzt werden. Je nach den jeweiligen Bedingungen entsteht dabei entweder CO2 oder das 23mal so effektive Treibhausgas Methan (CH4) (im Vergleich Molekül zu Molekül gerechnet über einen Zeitraum von 100 Jahren). 2006 haben russische und US-amerikanische Wissenschaftler den Kohlenstoff-Gehalt der Permafrostböden auf 900 Milliarden Tonnen abgeschätzt, was etwa 120 Prozent des gegenwärtigen CO2-Gehalts der Erdatmosphäre entspricht (Eine klimatische Zeitbombe im hohen Norden).
Zum anderen lagern große Mengen Kohlenstoff in unterschiedlicher Form unter den ausgedehnten, seichten Küstenmeeren vor Sibirien. Die Fläche und die Mengen, um die es geht, sind gewaltig. Das flache Schelfmeer umfasst rund 1,5 Millionen Quadratkilometer, ist also etwas größer als Frankreich, Spanien und Deutschland zusammen. Im Grunde handelt es sich um nichts anderes als eine geflutete Steppe, die während der letzten Eiszeit über dem Meeresspiegel lag, als die Weltmeere rund 120 Meter niedriger als heutzutage waren.
Entsprechend besteht der Boden dort meist wie unterm angrenzenden Land aus Permafrost, der allerdings wegen der Isolierung durch das Wasser deutlich wärmer als sein Gegenstück ist. Und ganz wie an Land sind in diesem Boden große Mengen organischen Materials konserviert. Die an der Universität von Fairbanks in Alaska arbeitende russische Wissenschaftlerin Natalia Shakhova sprach 2008 in Wien nach mehrjährigen Feldarbeiten auf der Versammlung der Europäischen Vereinigung der Geowissenschaften von rund 500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, der dort im Permafrost gebunden seien.
Hinzu kämen weitere 360 Milliarden Tonnen an freiem Methangas (CH4), das vom viele Meter dicken Permafrost wie von einem Deckel gehalten wird. Schließlich seien noch mindestens 540 Milliarden Tonnen in sogenannten Gashydraten unter oder im Permafrost gebunden. Gashydrate sind eine Verbindung aus Eis und Methan, wobei die CH4-Moleküle sozusagen in einem Käfig eingesperrt werden, den das Kristallgitter der Wassermoleküle bildet. Voraussetzung für diese unter atmosphärischen Bedingungen instabile Verbindung sind niedrige Temperatur und hoher Druck, bei sehr hohem Druck wie in größeren Tiefen an den Kontinentalrändern muss die Temperatur nicht ganz so niedrig sein.
Ein größerer Methanaustritt wird den Klimawandel erheblich beschleunigen
Seit einigen Jahren machen sich Geowissenschaftler zum Teil erhebliche Sorgen um die Stabilität dieser Lagerstätten. Verschiedene Expeditionen haben seit Mitte des letzten Jahrzehnts zum Teil extrem hohe Konzentrationen von Methan im Oberflächenwasser der sibirischen Küstenmeere registriert. Shakhova und ihre Kollegen halten einen Teil der Gashydrate für besonders gefährdet und gingen daher 2010 in einer Abschätzung davon aus, dass ein Reservoir von 50 Milliarden Tonnen Methan darauf wartet, mehr oder weniger jederzeit auszutreten.
Gail Whiteman von der Universität in Rotterdam sowie Chris Hope und Peter Wadhams von der Universität im britischen Cambridge haben sich nun der Frage angenommen, welche Folgen ein solcher Austritt zusätzlicher Treibhausgase haben könnte. In einem Kommentar in der neuesten Ausgabe des renommierten Fachblatts Nature berichten sie von ihren Berechnungen und erzeugten damit einiges Rauschen im Blätterwald.
Um den zusätzlichen wirtschaftlichen Schaden abzuschätzen, den ein entsprechender Methanaustritt haben würde, haben sie eine neuere Version des kombinierten Klima- und Ökonomiemodell PAGE benutzt, mit der seinerzeit 2006 in Großbritannien Nicholas Stern die Folgen des Klimawandels berechnet hatte (Umweltschutz aus ökonomischen Gründen). In dieses Modell haben sie dann die Emissionen von 50 Milliarden Tonnen CH4, verteilt über die Jahre 2015 bis 2025, als Randbedingung zusätzlich zu zwei verschiedenen Szenarien für die anthropogenen Emissionen eingegeben.
Das Ergebnis: Erwartungsgemäß würde ein größerer Methanaustritt den Klimawandel erheblich beschleunigen. Je nachdem, ob die Emissionen aus menschlichen Aktivitäten zügig zurückgefahren werden oder ein Business-as-usual-Szenario zugrunde gelegt wird, würde die Zeitspanne bis zu einer Erhöhung der globalen Temperatur auf zusätzliche zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau um 15 bis 35 Jahre verkürzt. Schon 2035 oder 2040 könnte diese Schwelle erreicht sein. Die Kosten des Klimawandels würden entsprechend um 35 bis 60 Billionen US-Dollar steigen. Letzteres entspricht etwa der jährlichen globalen Wirtschaftsleistung:
We calculate that the costs of a melting Arctic will be huge,(...)The release of methane from thawing permafrost beneath the East Siberian Sea, off northern Russia, alone comes with an average global price tag of $60 trillion in the absence of mitigating action --- a figure comparable to the size of the world economy in 2012 (about $70 trillion). The total cost of Arctic change will be much higher.
Whiteman, Hope und Wadhams, Nature 402, Vol 499
Die Autoren gehen davon aus, dass die tatsächlichen Kosten noch erheblich höher sein werden, da das Modell wichtige Faktoren wie die Versauerung der Ozeane nicht berücksichtigt. Außerdem weisen sie wie viele Umweltökonomen vor ihnen darauf hin, dass die schwersten Folgen von den Entwicklungsländern getragen werden müssen. In den gängigen Risikoabschätzungen des Weltwirtschaftsforums und des Internationalen Währungsfonds würden die etwaigen Folgen größerer Methanaustritte in der Arktis bisher fehlen.
Übrigens: Nahezu zeitgleich mit den Berichten über die Arbeit Whitemans und Kollegen geisterte durch die hiesigen Medien auch eine Meldung über Methanaustritt in Folge von Erdbeben, den deutsche Wissenschaftler vor der pakistanischen Küste nachweisen konnten. Auch wenn in diesem Zusammenhang von "riesigen Mengen" die Rede war, so ging es nur um einige tausend Tonnen Methan. Im Verhältnis zu den Mengen, um die es in der Arktis geht, ist das weniger als ein Fingerhut.
Was folgt nun aus den Abschätzungen der drei Nature-Autoren? Sie haben eine der beiden Säulen einer Risikoabschätzung geliefert, die aus Schaden und der Eintrittswahrscheinlichkeit besteht. Was ersteren angeht haben sie - wenig überraschend - belegt, dass eine Beschleunigung und Verstärkung der globalen Erwärmung schwerwiegende Folgen haben wird.
Wahrscheinlichkeit eines Methanaustritts
Ansonsten scheinen sie selbst zwar von einer relativ hohen Eintrittswahrscheinlichkeit auszugehen, allerdings war diese selbst nicht Gegenstand ihrer Untersuchung. Verschiedene Kritiker haben nach der Veröffentlichung des Nature-Kommentars angemerkt, dass es bisher keinen nachgewiesenen Mechanismus gebe, durch den derart große Mengen Methan freigesetzt werden könnten
Peter Wadham, der einzige Polarforscher des Autoren-Trios, widerspricht diesen Einwänden auf der Homepage seiner Universität. Es gebe bereits Beobachtungen von massiven Methan-Austritten. Das Meereis würde sich im Sommer inzwischen so weit zurückziehen, dass es über dem sibirischen Schelf inzwischen eine eisfreie Saison geb. Das Oberflächenwasser wäre dadurch um bis zu sieben Grad angestiegen, wie Satellitendaten zeigten. Da die Gewässer oft nicht viel tiefer als 50 Meter seien, gebe es ihnen anders als im offenen Ozean auch keine Schichtung. Der auf dem eisfreien Meer stärkere Wellengang sorge dafür, dass die Erwärmung bis in die Bodengewässer zu spüren sei.
Gavin Smith vom Goddard Institute for Space Studies der NASA und einer der Autoren der Website RealClimate verweist hingegen darauf, dass es vor 8.000 und vor 125.000 Jahren zwei bekannte Episoden gegeben hat, in denen sich das Meereis auf dem arktischen Ozean ebenfalls im Sommer weit zurückgezogen habe. Aus dieser Zeit seien jedoch keinerlei Anzeichen eines größeren Methanaustritts bekannt.
Mehr Forschung ist also noch nötig, um die Wahrscheinlichkeit eines Methanaustritts abzuschätzen. Dabei wären unter anderem die Dauer dieser Episoden und das regionale Klima, das in dieser jeweils geherrscht einzugrenzen. Aber eines ist schon jetzt klar: Der etwaige zusätzliche Schaden wird sehr hoch und vor allem von den ärmeren Nationen zu tragen sein. Wir haben also die Möglichkeit, bis zur letzten Gewissheit zu warten, bis klar ist, dass wir auch die Temperaturen, wie sie vor 8.000 und 125.000 Jahren geherrscht haben, wirklich überschreiten, oder wir fangen schon mal an, das Risiko zu minimieren, indem wir aus dem Verbrauch fossiler Brennstoffe aussteigen.