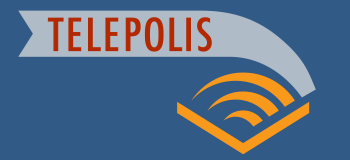Autonome Shuttles im Praxistest: Wie das KIT den ÖPNV auf dem Land zukunftsfähig macht

Fahrerlose Shuttles bieten nach neuesten Forschungen des KIT große Chancen für einen besseren ÖPNV auf dem Land.
(Bild: Felix Kästle, ZF Friedrichshafen / KIT)
Forscher des KIT haben autonome Shuttles im ÖPNV getestet. Die Ergebnisse zeigen: Die Technik ist bereit für den Regelbetrieb.
Der ÖPNV in ländlichen Räumen ist bei geringer Siedlungsdichte einerseits kaum wirtschaftlich darzustellen, anderseits fehlen ihm jedoch inzwischen oft die Fahrer, sodass immer wieder Kurse ungeplant ausfallen müssen und Termine kaum einzuhalten sind.
Für Strecken, die laut Fahrplan in einer Stunde zu bewältigen sind, benötigt man dann die mehrfache Zeit. Der Unmut der Fahrgäste geht dann über die Fahrer nieder, die sich das auf Dauer kaum bieten lassen wollen. Entsprechend hoch ist die Fluktuation beim Personal.
Da kommen jetzt auch in Deutschland autonome Shuttles ins Spiel, die hier für den öffentlichen Nahverkehr ein großes Potenzial und neue Möglichkeiten für flexible Angebote ermöglichen. Dies gilt vor allem im ländlichen Raum und in Randgebieten von Städten, wo viele bisher auf ihr privates Auto setzen, inzwischen jedoch immer häufiger mit fehlenden Parkmöglichkeiten konfrontiert werden.
Nicht nur reduzieren immer mehr Städte ihren Parkraum, auch die ländlichen Kommunen werden zusehends von der Flut der Pkws ihrer Einwohner überrollt. Wo bisher 1,5 Parkplätze pro Wohnung ausgewiesen werden müssen, finden sich inzwischen bis zu vier Fahrzeuge pro Mietwohnung, für die im öffentlichen Raum keinesfalls mehr genügend Platz zur Verfügung steht.
Selbst kleine Dörfer sehen hier inzwischen den einzigen Ausweg in einem Gemeindevollzugsdienst und dem Verteilen von Knöllchen.
Karlsruher Institut für Technologie zeigt Möglichkeiten
Verkehrsexpertinnen und -experten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben im Forschungsprojekt RABus gezeigt, dass die Lösung in selbstfahrenden Kleinbussen entstehen könnte.
In dem Projekt mit dem Langnamen ″Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land″ waren autonomen Kleinbusse monatelang in Mannheim und Friedrichshafen unterwegs. Getestet wurde, ob sie im Straßenverkehr funktionieren, die Menschen die Fahrzeuge akzeptieren und wie sich ein breites Shuttle-Angebot auf den Verkehr auswirken könnte.
In seinem Resümee stellte Martin Kagerbauer vom Institut für Verkehrswesen (IFV) des KIT fest, dass die Nutzer der neuen Technik sehr positiv und aufgeschlossen gegenüber stehen, wenn diese sicher sei und das Angebot gut kommuniziert werde.
In dem Projekt wurden mit umfangreichen Befragungen nicht nur eine hohe Akzeptanz, sondern auch ein großes Nutzungsinteresse an autonomen Shuttles über alle Bevölkerungsgruppen hinweg nachgewiesen. Man konnte zeigen, dass sich Vorbehalte durch Gespräche und das Erleben der Technik signifikant abbauen lassen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externer Inhalt geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Seit Oktober 2024 testeten die Regionen Mannheim und Friedrichshafen jeweils zwei autonome Shuttle-Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr. Die Testphase umfasste etwa 430 Fahrten mit mehr als 1.600 Testpersonen. Die Fahrzeuge absolvierten dabei über 2.100 Kilometer im automatisierten Modus und zeigten dabei eine zuverlässige und sichere Leistung.
Der Betrieb war nicht nur bei strahlendem Sonnenschein und zu verkehrsberuhigten Zeiten erfolgreich, sondern auch unter widrigen Wetterbedingungen und bei dichtem Verkehr. Sie fuhren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern, die von Bussen in vergleichbaren Projekten in Deutschland bisher noch nicht erreicht wurde.
Aufgrund des leergefegten Personalmarkts setzt die Politik auf automatisierte Mobilität
Mit dem Projekt RABus wurde offensichtlich gezeigt, dass automatisiertes Fahren im öffentlichen Verkehr kein Zukunftsversprechen, sondern bereits heute erlebbar ist, wie Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann feststellte. Die Rückmeldungen aus dem Projekt sollen zeigen, dass Menschen, die die automatisierte Mobilität selbst erleben können, Vertrauen in die neue Technologie gewinnen können.
Hermann sieht Baden-Württemberg in diesem Projekt als Gestalter und Erprobungsraum für innovative Mobilitätslösungen. Dies sei ein starkes Signal für den ÖPNV der Zukunft, insbesondere in ländlichen Regionen. Jetzt steht das Ziel an, automatisierte Angebote aus dem Testbetrieb in den Regelbetrieb zu bringen und damit Mobilität für alle und nicht nur für PKW-Besitzer zugänglich zu machen.
Anhand von Simulationsmodellen zeigt das Karlsruher Projekt Potenzial für einen künftigen Regelbetrieb in ganz Baden-Württemberg. ″Vielversprechende Anwendungsgebiete haben wir in nahezu allen Gemeinden Baden-Württembergs gefunden. Der bestehende ÖPNV würde durch eine Ergänzung mit Shuttles deutlich attraktiver und könnte so zusätzliche Fahrgäste gewinnen″, lässt sich Kagerbauer zitieren,
Daher sollen die Fahrzeuge in Friedrichshafen auch nach Projektende weiterhin zu Testzwecken eingesetzt werden, um das gewonnene Know-how für die Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens zu nutzen.
Das Projekt RABus wurde vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert und vom Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) koordiniert. Neben dem KIT waren die Stadtverkehr Friedrichshafen (SVF), Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), Rhein-Neckar-Verkehr sowie die ZF Friedrichshafen beteiligt.