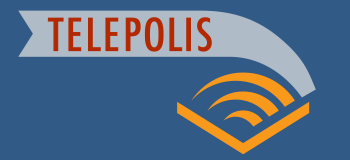Aufrüstung: Wie die Bundesregierung den Sozialstaat opfert

Die Bundesregierung setzt auf massive Aufrüstung. Sozialausgaben werden gekürzt. Der soziale Frieden steht auf dem Spiel. Analyse.
"Mit Sozialleistungen und mit Bildung lässt sich dieses Land nicht verteidigen," konstatierte Verteidigungsminister Boris Pistorius und verdeutlichte die neue Priorität der deutschen Haushaltspolitik.
Nun haben sich, wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Den Haag die Bündnisstaaten (mit Ausnahme von Spanien), nach Informationen von Nachrichtenagenturen offenbar darauf geeinigt, dass sie künftig – bis zum Jahr 2035 – fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukt für Verteidigungsausgaben bereitstellen wollen.
Und da Geld nicht vom Himmel regnet, wie Bundeskanzler Friedrich Merz der Öffentlichkeit eingeschärft hat, sind die aus diesen Plänen resultierenden Sparzwänge in anderen Bereichen, insbesondere dem Sozialbudget, leicht zu prophezeien.
Stärkste Armee Europas
Die aktuelle Entscheidung ist nur der neue Höhepunkt einer längeren Entwicklung: Der Bund hatte bereits im Jahr 2022 das Sondervermögen Bundeswehr errichtet und mit einer eigenen Kreditermächtigung von bis zu 100 Milliarden Euro ausgestattet.
Im Mai dieses Jahres wurde dann beschlossen, die Verteidigungsausgaben weitgehend von der Schuldenbremse auszunehmen. Der Bundeskanzler gibt die Marschrichtung vor: "Whatever it takes". Sein Ziel ist nicht nur die Verteidigungsfähigkeit.
Deutschland solle die "konventionell stärksten Armee" Europas haben, sagt der Kanzler.
Die EU will 800 zusätzliche Milliarden Euro für Verteidigungsvorhaben aufbringen. 150 Milliarden sind durch den EU-Haushalt abgesicherte Kredite. Weitere 650 Milliarden Euro sollen finanziert werden, indem die sonst so strikten Schuldenregeln gelockert werden.
Zudem haben die Nato-Minister die Erhöhung der Militärausgaben um 30 Prozent beschlossen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte schlug vor, die Länder sollten bis zum Jahr 2032 mindestens 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für das Militär und 1,5 Prozent des BIP für verteidigungsrelevante Infrastruktur einsetzen.
Milliarden und Milliarden
Letztes Jahr belief sich der deutsche Verteidigungshaushalt auf knapp 52 Milliarden Euro. Das anvisierte Fünf-Prozent-Ziel des BIP entspricht nach heutigem Stand etwa 225 Milliarden Euro.
Eine mehr als vierfache Erhöhung. (Zum Vergleich: die Kosten, um in nur wenigen Jahren weltweit den Hunger zu beenden, belaufen sich auf 37 Milliarden Euro, 15 Prozent des zukünftigen deutschen Verteidigungshalts).
Beim aktuellen Bundeshaushalt von 488 Milliarden würde das vorgesehene Ziel etwa 45 Prozent der Steuereinnahmen ausmachen. Fast jeder zweite Euro.
Alternativlose Aufrüstung
Befürworter der Zielvorgabe "Kriegstüchtigkeit" finden die Gründe für die radikale Politikänderung in Moskau und Washington.
Während man sich seit der Präsidentschaft Donald Trumps der Geschlossenheit der Nato in einem möglichen Verteidigungsfall nicht mehr sicher sein kann, erscheint die russische Absicht Nato-Länder anzugreifen, neuerdings unzweifelbar und somit werden massive Investitionen in die "Kriegstüchtigkeit" als das alternativlose Gebot der Stunde behandelt.
"Man muss davon ausgehen, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, einen Nato-Staat anzugreifen," warnt Pistorius. Vorausgegangen waren Verlautbarungen des Generalinspekteurs der Bundeswehr Carsten Breuer, Marine-Vizeadmiral Jan Christian Kaack.
Russland sei bis 2029 in der Lage, die Nato zu attackieren. Der BND-Chef Bruno Kahl spricht sogar von Beweisen für russische Überlegungen zum Angriff auf die Nato.
Alternativloser Verzicht auf Diplomatie
Nahezu geschlossene Einigkeit herrscht auch in der Überzeugung, dass die Ablehnung von diplomatischen Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges alternativlos sind. Nicht zuletzt bei der vehementen Ablehnung des Manifests rund um Ralf Stegner ist dies einmal mehr zu beobachten.
Kein Zweifel scheint darin zu bestehen, dass Putin nur die Sprache der Stärke verstehe (Tagesschau) und dass Russland nicht verhandeln wolle. Auch wenn Istanbul 2022 möglicherweise das Gegenteil bewiesen hat.
Damit schreibt die deutsche und die EU-Außenpolitik ihre Grundhaltung seit dem 22. Februar 2022 unverändert fort. Eine harte Politik ist alternativlos, diplomatische Initiativen eine "Realitätsverweigerung":
Felsenfestes Bekenntnis
Angesichts der wohl beschlossenen 5-Prozent-Regel zeigt sich Generalsekretär Mark Rutte erfreut und sprach von "Amerikas felsenfestem Bekenntnis zur Nato".
Auch der US-amerikanische Präsident Donald Trump dürfte sich freuen. Seine Strategie, den Bündnisstaaten der Nato zu zeigen, die Unterstützung der USA hänge selbst im Bündnisfall von seinem persönlichen guten Willen ab, hat letztendlich dazu geführt, dass er genau das erreicht hat, was er schon im letzten Winter gefordert hat: die 5-Prozent-Regel für alle Nato-Staaten.
Paradoxerweise hat also das erklärte europäische Ziel mit massiv erhöhten Militärausgaben sich verteidigungspolitisch unabhängig vom Gemüt Trumps zu sein genau dazu geführt, dass nun stolz die Geschlossenheit der Nato unter dem felsenfesten Schutz der USA verkündet wird.
Sozialer Sprengstoff
Angesichts der massiven Mehrausgaben für die "Kriegstüchtigkeit", sollte man auch einen Blick auf die soziale Lage der Menschen in Deutschland werfen:
- Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist die höchste in Europa. Ohne staatliche Eingriffe wird diese in den nächsten Jahren weiter ansteigen.
- Der mittlere Wert der Nettovermögen deutscher Haushalte ist in zwei Jahren deutlich von 90.500 Euro auf 76.000 Euro zurückgegangen. "Die Wahrheit: Deutschland verarmt", so der frühere Chefökonom von Barclays Capital Thorsten Polleit. • Human Rights Watch mahnt, viele Menschen seien "in einem Ausmaß von Armut betroffen, das ihre Menschenrechte verletzt".
- Fast jeder fünfte Mensch ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.
- Jedes siebte Kind ist armutsgefährdet.
- 1,2 Millionen Vollzeiterwerbstätige leben in erheblichen materiellen Entbehrungen.
- Die deutsche Industrie baut mehr als 100.000 Jobs binnen eines Jahres ab.
- Mehr als zwei Millionen Rentner leben unter der Armutsgefährdungsgrenze. Ein Rekordhoch.
- Der Anteil der Rentner, die berufstätig sind, hat sich in den letzten 20 Jahren verdreieinhalbfacht.
- Zwei Millionen Menschen bedürfen der Hilfe durch Lebensmitteltafeln, aber deren ehrenamtlichen Mitarbeitern geht die Kraft aus.
- Die Wohnungsnot in Deutschland nimmt zu. Es fehlen 550.000 Wohnungen.
Aber auch ohne harte Zahlen reicht ein Spaziergang durch eine deutsche Großstadt aus, um zu erkennen, wie gravierend sich die soziale Lage verschlechtert hat. Die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, konstatiert ernüchtert eine "zunehmende Verwahrlosung" der Stadt.
Soziale Zeitenwende
Deutschland hat ein vielfältiges Hilfsangebot im sozialen Bereich. Aber nicht zuletzt aufgrund der bisherigen Sparpolitik steht es vor dem Abgrund:
- Die Lage des soziales Sektors ist katastrophal.
- Die Lage der Psychiatrien ist katastrophal.
- Die Lage der deutschen Kitas ist katastrophal.
- Die Lage der deutschen Pflege ist katastrophal.
- Die Lage der gesetzlichen Pflegeversicherungen ist katastrophal.
- Die Lage der gesetzlichen Krankenkassen ist katastrophal. Sie sind massiv verschuldet.
Der Paritätische Gesamtverband fordert daher angesichts der massiven Probleme in Deutschland "eine soziale Zeitenwende".
Demokratie am Spartropf
Regelmäßig wird vor der Gefahr des aufkommenden Rechtsextremismus gewarnt. Die Demokratie müsse wehrhaft werden. Dabei wird die zentrale gesellschaftliche Rolle von Armut und Ungleichheit galant verkannt.
Denn "wenn der Anteil von Haushalten unter der Armutsgrenze um einen Prozentpunkt steigt, steigt der Stimmenanteil von rechtsextremen Parteien um 0,5 Prozentpunkte bei Bundestagswahlen," wie das Ifo-Institut feststellt.
Und eine Studie, die die Bundesregierung in Auftrag gab, mahnt zudem: "Es besteht auch eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen."
Das Ausmaß der Ungleichheit wirkt sich auch negativ auf die Zufriedenheit der Menschen mit Demokratie aus. "Ohne Sozialpolitik, die Armut entschieden überwinden möchte, wäre die Demokratie jederzeit in Gefahr", stellt der "Schattenbericht: Armut in Deutschland" der Diakonie Deutschland (Tagesschau) fest.
Ungleichheit tötet
Die Epidemiologen Kate Pickett und Richard Wilkinson haben die Daten von 23 der fünfzig reichsten Länder untersucht: Zahlreiche Probleme sind umso gravierender, je höher der Grad der Ungleichheit ausfällt: Gleichberechtigung von Frauen, Mobbing, Scheidungsrate und Anzahl von Teenager-Schwangerschaften, Gewalttaten, Kindesmisshandlungen, Mord, Amokläufe, Anzahl der Gefängnisinsassen, Drogenkonsum, fehlende Solidarität, Misstrauen, fehlende Hilfsbereitschaft und soziale Mobilität.
Ungleichheit hat aber auch eine massive Auswirkung auf die Lebenserwartung. Mehr Gleichheit rettet Lebensjahre.
Seine jahrzehntelange Forschung fasst der Epidemiologe Michael Marmot auf der Rückseite des Abschlussberichts einer Kommission der Weltgesundheitsorganisation zusammen, die er geleitet hat: "Soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen in großem Stil."
Sozialpolitik für Wohlbetuchte
Angesichts dieser verheerenden Entwicklung ist die Regierungspolitik höchst bedenklich: Statt konkret Lösungen wie Vermögenssteuer, Angleichung der Kapitalsteuer an die Steuer aus Arbeit, Maßnahmen gegen den Schattenfinanzplatz Deutschland und eine gerechtere Steuerpolitik anzugehen, kennt die Bundesregierung einzig das altbekannte Mantra des Neoliberalismus.
Sparmaßnahmen, die fast ausschließlich die ärmere Hälfte der Bevölkerung treffen: eine härtere Gangart bei vermeintlichen Arbeitsverweigerern, mehr Arbeit und späteres Renteneintrittsalter (was einmal mehr angesichts der deutlich geringeren Lebenserwartung ärmerer Menschen, diese gleich doppelt trifft).
Es gibt immer Alternativen
Angesichts des bedrohlichen sozialen Sprengstoffs stellt sich die Frage: Was muss eigentlich noch alles genau geschehen, damit die soziale Problemlage das ehrliche Interesse der Politik erfährt und nach Lösungen gesucht wird, um Menschenleben zu retten und zu schützen?
Die angebliche Alternativlosigkeit der Verteidigungspolitik überlagert in jeder Hinsicht die objektive Alternativlosigkeit, die soziale Frage zu beantworten. Dabei steht hier wohlgemerkt nicht die Notwendigkeit der Verteidigungsfähigkeit zur Debatte, sondern das panische "whatever it takes", weil angeblich "der Russe vor der Tür steht" (Jens Spahn).
Wohlgemerkt eine Reihe von Experten bezweifelt, dass Russland die Nato angreifen will - z. B. Oberst a. D. Wolfgang Richter, Politikwissenschaftler Johannes Varwick und Brigadegeneral a. D. Reiner Schwalb:
Während alternativlos Summen, die die Vorstellungskraft übersteigen, für Kriegstüchtigkeit veranschlagt werden, und nur Spanien mit Verweis auf die Bedeutung des Wohlfahrtsstaats sich diesem Ansinnen widersetzt, hat Michael Marmot im Hinblick auf die ganz konkreten Opfer der Sparpolitik einen Rat:
Was wäre, wenn jedes Mal, wenn ein Politiker sagte, er wolle die Leistungen für die Armen kürzen, ein kleiner Vogel ihm ins Ohr flüsterte: Weniger Sozialausgaben bedeuten, dass sich die Gesundheit der Menschen verschlechtert, wenn nicht sogar, dass sie sterben.
Die Erkenntnis, dass man Panzer nicht essen kann und Raketen keine soziale Beratung schenken, sollte sich herumgesprochen haben. Alles andere ist Realitätsverweigerung.
Literatur: Michael Marmot: The Health Gap