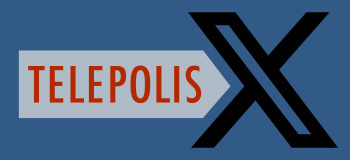Verräter oder Visionäre? Wie ein Friedensmanifest die SPD spaltet – und was das für Deutschland bedeutet

120 SPD-Mitglieder fordern in einem Manifest mehr Diplomatie mit Russland. Die Parteiführung reagiert empört auf den Vorstoß. Was die Initiatoren damit riskieren, ahnen sie noch nicht.
Die 120 SPD-Mitglieder, die als Erstunterzeichner des umstrittenen Friedensmanifests fungierten, wurden von eigenen Parteimitgliedern und den Vertretern anderer Parteien heftig kritisiert und teilweise auch persönlich diskreditiert. Auf dem Parteitag der SPD Ende Juni sollte es nun zum Showdown kommen.
Aber entgegen der medial geäußerten Erwartungen wurden die Inhalte des Manifests nur in Ansätzen auf dem Parteitag thematisiert.
Zunächst fanden sich nur wenige außen- und sicherheitspolitische Anträge im Antragswerk des Bundesparteitags der SPD, noch weniger hiervon ließ die Antragskommission zur Befassung auf dem Parteitag zu. Hier wird wieder deutlich, dass Antragskommissionen auch als Bollwerk gegen unerwünschte Diskussionsimpulse während eines Parteitages fungieren.
Es wurde daher wohl auch von den Manifest-Initiatoren im Vorhinein kein expliziter Antrag zum Manifest gestellt.
Reaktionen der Medien nach dem Parteitag thematisieren nur zum Teil das Manifest, da es dort in der Tat nicht die zentrale Rolle spielte. Im Mittelpunkt standen hier eher der mit überwältigender Mehrheit angenommene Antrag zum AfD-Verbot sowie Klingbeils niedriges Wahlergebnis und das hohe Ergebnis für die Co-Vorsitzende Bärbel Bas.
Lars Klingbeil selbst hatte in seiner Parteitagsrede nur kurz die Thematik angesprochen und sich vorwurfsvoll gegen die Initiatoren des Manifests gewendet („Wladimir Putin ist nicht Michail Gorbatschow.“) – als wenn dies irgendjemand behauptet hätte … Stegner wandte hingegen u. a. während des Parteitages ein: ”Glaubt irgendjemand, dass die Waffen nicht eingesetzt werden, wenn wir so viel Hochrüstung haben?“
Die taz berichtete, dass sich auf dem Parteitag interessanterweise vorwiegend jüngere SPD-Mitglieder gegen die Aussagen des Manifests und insbesondere gegen die dort gesehene Annäherungsabsicht an Russland gewendet hätten.
Dann gab es einen während des Parteitages gestellten Initiativantrag, der gegen die Willkürlichkeit des FnfProzent-Ziels der NATO gerichtet war, von der Parteitagsmehrheit abgelehnt wurde, aber immerhin von 35% der Delegierten angenommen wurde („Die SPD lehnt eine dauerhafte und starre Festlegung der Rüstungsausgaben von fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes ab. (…)“).
Möglicherweise ist auch das mit knapp 65 Prozent der Stimmen schlechte Wahlergebnis für Lars Klingbeil als Co-Vorsitzender u.a. auf sein unbedingtes Beharren hinsichtlich der vorgenommenen sicherheitspolitischen Weichenstellungen der Bundesregierung zurückzuführen. Teile der friedenspolitisch orientierten Linken in der SPD haben ihn dann wohl nicht mehr gewählt.
Ralf Stegner im Rampenlicht
Rolf Mützenich hatte das Manifest lediglich unterschrieben. Auch kam der ehemalige SPD-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, der von Klingbeil zur Seite geschoben wurde, nicht einmal mehr zum SPD-Parteitag. Im Mittelpunkt der Berichterstattung und der nachträglichen Fernsehauftritte stand daher Ralf Stegner, der durch sein Engagement wohl auch seinen Sitz im wichtigen Parlamentarischen Kontrollgremium verlor, das für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig ist.
Stegner widerspricht im Interview dem Vorwurf, die Unterzeichner seien Handlanger Putins mit deutlichen Worten:
„Putin ist ein Kriegsverbrecher, ja – aber Verhandlungen mit Leuten, deren Werte man nicht teilt, bleiben nötig. Langfristig wird Russland westliche Technologie brauchen. Die Allianzen mit Nordkorea und Iran werden nicht reichen. Darauf müssen wir setzen. Ich bin kein Pazifist oder Fantast, ich sage nur, es gibt keine Alternative.“
Zudem verweist er auf eine repräsentative YouGov-Umfrage, in der knapp die Hälfte der deutschen Bundesbürger (47 Prozentg) für eine Stärkung der Diplomatie mit Russland aussprechen. Nur 29% halten den gegenwärtigen Umfang an Diplomatie für angemessen.
Hinsichtlich des Umgangs der Parteiführung mit dem Friedensmanifest äußert sich Stegner im gleichen Interview kritisch:
„Ich wünsche mir, die Parteiführung würde Debatten nicht nur dulden, sondern aktiv befördern. Die SPD braucht inhaltliche Breite und muss verschiedene Milieus ansprechen, wenn sie eine Volkspartei sein will. Die Rückmeldungen zeigen mir, meine Position ist kein Randthema. Wir brauchen gemeinsame Sicherheit – nicht nur vor Russland, sondern irgendwann – nach einem für die Ukraine akzeptablen Frieden – auch wieder mit Russland.“
Notwendiger Umgang mit unterschiedlichen friedenspolitischen Positionen in einer Gesellschaft mit demokratischem Anspruch
Demokratisch orientierte Gesellschaften müssen unterschiedliche Meinungen und kontroverse öffentliche Äußerungen zur Friedenspolitik aushalten, sogar fördern – um maßvoll auf ein Szenario reagieren zu können, das durch eine militärische Eskalation und mögliche Bedrohung gekennzeichnet ist. In autoritären Gesellschaften wird dieser Diskussionsprozess vorzeitig abgebrochen bzw. findet hinter verschlossenen Türen statt, um die Durchsetzung der Interessen und Ziele der Regierungsspitze zu gewährleisten.
Es ist kritisch zu begleiten und zu analysieren, inwieweit die notwendigen Diskursräume in einer Gesellschaft mit demokratischem Verfassungsanspruch, wie der Bundesrepublik Deutschland, politisch nicht gewollt und medial vernichtet werden, wenn die in einer Gesellschaft dominierenden Kreise die Auffassung vertreten, sich in einer beginnenden Kriegssituation zu befinden.
Die öffentliche Diskreditierung der am friedenspolitischem Manifest der SPD-Linken beteiligten Personen ist dann Ausdruck innerer Mobilisierung und einer zunehmenden Militarisierung gesellschaftlicher Strukturen. Dies wäre dann Ausdruck einer sich in der Krise befindlichen Demokratie, die selbst unter einem enormen Druck steht und notwendigen Meinungspluralismus zugunsten einer formierten Gesellschaft wiederum zu unterdrücken versucht.
Sicherheitspolitische Einordnung und Schlussfolgerungen
Letztendlich ist die Schlüsselfrage zu klären: Ist tatsächlich ein russischer Angriff gegen NATO-Staaten zu erwarten oder handelt es sich hier um einen interessengeleiteten Alarmismus, der zu einer unverhältnismäßigen Aufrüstung führt und die gesellschaftlichen Zukunftsmilliarden in eine destruktive Richtung lenkt?
Diese Frage ist nicht leicht(fertig) zu beantworten. Die anhaltende militärische Aggression gegen die Ukraine, die massive Aufrüstung Russlands verbunden mit einer Umstellung zu einer weitgehenden Kriegswirtschaft, die Kriegsrhetorik der russischen Staatsspitze und in den russischen Medien sowie das Ausschlagen an Kompromissen orientierter Verhandlungsangebote bei gleichzeitiger Zunahme der Bombardements in der Ukraine im Frühjahr und Sommer 2025 sprechen für eine militärische Gefährdung durch Russland. Dies bedeutet, dass die Europäische Union sowie Deutschland durchaus ihre Verteidigungsmöglichkeiten verbessern, sich auch dringend besser hinsichtlich militärischer Operationsfähigkeiten und gemeinsamer Militärtechnologie abstimmen müssten. Dies wird auch in dem Manifesttext so gesehen, der die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas einfordert. Dennoch ist es angesichts der militärischen Überlegenheit auch der europäischen NATO-Staaten, was die Zahl des Personals und die Anzahl der Waffen angeht, und u.a. der Ergebnisse des NATO-Gipfels im Juni 2025 hinsichtlich der Bekräftigung der gemeinsamen Beistandsverpflichtung eher unwahrscheinlich, dass Russland es in absehbarer Zeit wagt, einen NATO-Staat anzugreifen. Auch spricht hierfür die relative Erfolgslosigkeit Russlands bei der militärischen Eroberung der Ukraine in den letzten 3,5 Jahren bzw. der vollständigen Besetzung der bereits in der russischen Verfassung annektierten östlichen und südöstlichen Gebiete der Ukraine.
Im Text des Manifests wird eine „defensive Ausstattung der Streitkräfte“ im Rahmen einer prioritären Verteidigungsarmee gefordert. Hier stellt sich die Frage, ob sich eine Armee primär auf Verteidigung ausrichten und auf einseitige Angriffswaffen, also auf das Prinzip Abschreckung verzichten kann.
Sicherlich sind die von der US-Regierung für 2026 vorgesehenen Raketenstationierungen auf deutschem Gebiet keine Verteidigungswaffen, sondern aggressive 'Enthauptungswaffen', die der Abschreckung dienen sollen. Waffensysteme wie 'Patriot' oder 'Iris-T' sind im Gegensatz hierzu eher Verteidigungssysteme.
Auch Bergungspanzer, Minensuchpanzer sowie Rettungswagen sind defensiver Natur. Aber was ist etwa mit Artillerie, Panzern und Kampfdrohnen? Sie können sowohl für den Angriff als auch zur Verteidigung eingesetzt werden.
Diskussionswert ist auch die Perspektive, die im Manifest entwickelt wird – im Rahmen einer aus militärischer Verteidigungsfähigkeit und Diplomatie bestehenden sicherheitspolitischen Doppelstrategie - den Aspekt der Vertrauensbildung über Diplomatie als Voraussetzung international koordinierter Abrüstungsbemühungen zu stärken.
Lieber nach wiederholten diplomatischen Niederlagen dann dennoch nach zähem didiplomatischemingen einen Erfolg in der Zusammenarbeit erzielen als vorschnell in eine Kriegssituation geraten!
Auch wird sich der Krieg in der Ukraine nur über Verhandlungen beenden lassen, wenn beide Seiten erkennen, dass ein Verhandlungsfrieden eine Win-win-Situation in ökonomischer und geopolitischer Hinsicht für beide Kriegsparteien bedeutet und über das hinausgeht, was sich über militärische Mittel erzielen lässt.
Diese Erkenntnis, dass es mit militärischen Mitteln nichts mehr zu gewinnen gibt und der gemeinsame Vorteil in einer Beendigung des Krieges liegt, könnte über entsprechende ökonomische und politische Angebote vonseiten des Nato-Westens an beide Kriegsgegner begünstigt werden.
Klaus Moegling ist Politikwissenschaftler und -didaktiker. Er lehrte u.a. an der Universität Kassel im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Sein Buch „Neuordnung. Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich.“ ist in seiner 6. aktualisierten und erweiterten Auflage frei lesbar: https://www.klaus-moegling.de/aktuelle-auflage-neuordnung/