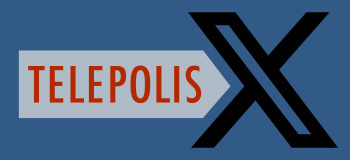Libanon in der Krise: Droht Europa eine neue Flüchtlingswelle?

Syrische Flüchtlinge im Bekaa-Tal im Libanon im Jahr 2013
(Bild: Sebastian Castelier / Shutterstock.com)
Die Libanon-Krise zwingt Tausende zur Flucht, während Europa unvorbereitet scheint. Steht eine neue Flüchtlingswelle bevor? Ein Gastbeitrag.
Die israelische Invasion im Libanon, die Ende September begann, hat die bereits von humanitären Katastrophen heimgesuchte Region des Nahen Ostens noch weiter ins Elend gestürzt. Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben bis zum 23. Oktober ihre Heimat im Libanon verlassen, und Zehntausende versuchen, ins Ausland zu fliehen.
Aus Sicht der Europäischen Union (EU) könnten die begrenzten legalen Migrationswege in Verbindung mit dem bereits erhöhten Migrationsdruck zu einer Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015 führen.
Während diese Migrationsströme zunehmen, muss Europa die unmittelbaren humanitären Bedürfnisse mit den langfristigen Fragen der Ansiedlung und Integration von Flüchtlingen in Einklang bringen. Das derzeitige politische Umfeld auf dem Kontinent stellt dies jedoch vor große Herausforderungen.
Libanesische Flüchtlinge auf dem Weg nach Syrien
Als der Arabische Frühling 2011 Syrien erreichte, wurde der Libanon zur Heimat von rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen. Heute kehrt sich diese Bewegung um, da der israelisch-libanesische Konflikt sowohl syrische Flüchtlinge als auch libanesische Einwohner über die Grenze nach Syrien treibt.
Bis zum 21. Oktober 2024 haben schätzungsweise 425.000 Menschen den Libanon verlassen und die nächstgelegene Grenze nach Syrien überquert. Darüber hinaus haben etwa 16.700 Libanesen im Irak Zuflucht gesucht.
Der israelisch-libanesische Konflikt steckt noch in den Kinderschuhen, und viele dieser Flüchtlinge gehen im Moment dorthin, wo sie können. Sie verdeutlichen jedoch das Ausmaß der erzwungenen Vertreibung, die bereits im Gange ist.
Mit der Zeit werden sich viele von ihnen auf den Weg nach Europa machen, was den Migrationsdruck auf die EU erhöhen wird, ähnlich wie bei der Flüchtlingskrise von 2015, als mehr als eine Million Flüchtlinge hauptsächlich – aber nicht ausschließlich - über die Mittelmeerrouten nach Europa kamen.
Es scheint, dass Europa diese Entwicklung nicht vorhergesehen hat. Erst vor wenigen Monaten, im Mai dieses Jahres, kündigte die EU ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro für den Libanon an, um die Migrationskrise an der Wurzel zu bekämpfen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Mittel ausreichen werden, um die Region zu stabilisieren oder die Massenmigration zu stoppen.
Tatsächlich könnte der Libanon, der bereits am Rande des politischen Zusammenbruchs steht, bald nicht mehr in der Lage sein, sinnvolle Migrationskontrollen zu koordinieren.
Im weiteren Kontext eines äußerst volatilen Nahen Ostens wird dies den Druck auf Europa erhöhen. Je instabiler die Region wird, desto mehr Migranten und Asylbewerber werden über Länder wie Griechenland und Italien, die an den Frontlinien der Migrationsrouten liegen, nach Europa kommen.
Kann die EU alle Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufnehmen?
Rein materiell und wirtschaftlich haben Länder wie Deutschland gezeigt, dass es möglich ist, eine große Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen.
Im Jahr 2015 kamen mehr als eine Million Flüchtlinge, die meisten von ihnen Syrer, nach Deutschland, und viele von ihnen tragen nun zur Arbeitskraft des Landes bei. Syrer und ihre Familien haben auch dazu beigetragen, den Binnenkonsum in Deutschland zu steigern und eine alternde Bevölkerung zu unterstützen, was zeigt, wie Migration ein positives Instrument sein kann, wenn sie effektiv gesteuert wird.
Die politische Landschaft hat sich jedoch verändert. Die wachsende Unterstützung für einwanderungsfeindliche Parteien hat zu einer tieferen gesellschaftlichen Spaltung über die Aufnahme von Flüchtlingen geführt. Die öffentliche Meinung hat sich dahingehend verändert, dass strengere Grenzkontrollen und eine geringere Aufnahme von Migranten gefordert werden.
Dieser anhaltende Trend hat sich seit den Europawahlen 2024, bei denen konservative und rechtsextreme Parteien erheblich an politischem Boden gewonnen haben, noch verstärkt.
Die unentschlossene Reaktion der EU auf die Krise spiegelt sich in ihren schwachen politischen Bemühungen wider, wie zum Beispiel das jüngste Versprechen, 31.000 Flüchtlinge in den Jahren 2024 und 2025 umzusiedeln. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein – mehr als 16 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene warten derzeit im Nahen Osten und Nordafrika (Mena) auf eine Neuansiedlung.
Ob die EU alle Flüchtlinge aus dem Libanon und anderen Konflikten im Nahen Osten aufnehmen könnte, ist daher eine komplizierte Frage. Während es auf dem Papier wirtschaftlich machbar – und zweifellos langfristig vorteilhaft – wäre, scheint ein solcher Schritt politisch außer Reichweite. Stattdessen wird der Ansatz der EU in dieser anhaltenden Krise durch ihre Einheit (oder deren Fehlen) in einer gemeinsamen Politik bestimmt.
Die künftige Migrationspolitik der EU
Deutschlands Erfolgsgeschichte im Umgang mit syrischen Flüchtlingen unterstreicht das langfristige Potenzial der Migration zur Stärkung der EU-Wirtschaft. Politische Spaltungen machen eine solche Politik jedoch politisch problematisch, wie Deutschland selbst zeigt, das kürzlich wieder Kontrollen an allen seinen Landgrenzen eingeführt hat, um die Migrationskontrolle zu verschärfen.
Der neue Migrations- und Asylpakt der EU schlägt Maßnahmen wie Umsiedlung und finanzielle oder operative Unterstützung der Mitgliedstaaten vor. Dieser Ansatz zielt darauf ab, humanitären Erfordernissen gerecht zu werden, ermöglicht es den Mitgliedstaaten aber auch, ihre Souveränität und Kontrolle zu wahren.
Er stellt aber auch die Kohärenz der eigenen Werte der EU in Frage. Indem die EU, wie der Rat es formuliert, "bei der Einrichtung von Aufnahmezentren hilft", könnte sie die erzwungene und manchmal illegale Rückführung von Migranten in Nicht-EU-Länder ermöglichen.
Solche Maßnahmen übersehen auch, was Migration einem Kontinent bieten kann, der mit demografischen Problemen zu kämpfen hat.
Um solche Ergebnisse zu erzielen, muss die neu ernannte Kommission jedoch nicht nur politischen Widerstand überwinden, sondern auch sicherstellen, dass die von ihr verabschiedeten Politiken realistisch eine ordnungsgemäße Integration ermöglichen.
Wie die EU Migration besser steuern kann
Mehrere Schlüsselmaßnahmen können Europa helfen, die drohende Migrationskrise zu bewältigen.
Die Ausweitung legaler Migrationswege – einschließlich Umsiedlungsprogrammen, humanitärer Visa und flexibler Arbeitserlaubnisse für libanesische Staatsbürger – ist entscheidend, um den Migrationsdruck zu verringern. Darüber hinaus kann die Verbesserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen durch mehr finanzielle und logistische Hilfe für den Libanon und seine Nachbarn dazu beitragen, die Migrationsströme nach Europa zu verlangsamen.
Eine bessere Koordination zwischen den EU-Staaten – so schwierig dies heute auch erscheinen mag – ist ebenfalls notwendig, um Grenzkontrollen mit der Achtung humanitärer Prinzipien in Einklang zu bringen.
Schließlich sollten Integrationsprogramme auf erfolgreichen Modellen wie den deutschen Erfahrungen mit syrischen Flüchtlingen basieren. Die EU muss aber auch die Ursachen von Instabilität durch Diplomatie und Entwicklungsinitiativen angehen.
Konkret bedeutet dies, eine starke diplomatische Haltung gegenüber Israel einzunehmen und generell die langjährige Schwäche und Unentschlossenheit der EU im Umgang mit ihren Nachbarn in der Mena-Region zu überwinden.
In einem Papier aus dem Jahr 2010 heißt es, die EU sei lange Zeit "ein Zahler, kein Spieler" gewesen. Wenn sich dies ändert, könnte die EU potenziell verhindern, dass Millionen von Menschen überhaupt zu Flüchtlingen werden.
Barah Mikaïl ist außerordentlicher Professor für internationale Sicherheit an der Saint Louis University Madrid Campus und an der IE University sowie Direktor des Observatoriums für zeitgenössische Krisen. Er ist außerdem Gründer von Stractegia, einem in Madrid ansässigen Beratungsunternehmen, das sich mit der Geopolitik der Mena-Region und der spanischen Politik befasst.
Dieser Text erschien zuerst auf The Conversation auf Englisch und unterliegt einer Creative-Commons-Lizenz.