Im Schattenhaus: Bei den Geistern der Vergangenheit

Informe general
Mit Christopher Lee im Lande des spanischen Diktators, Teil 2
Teil 1: Dracula und die Faschisten: Mit Christopher Lee im Lande des spanischen Diktators
1974 veröffentlichte der Vatikan die Namen der beiden gefährlichsten Filmemacher Spaniens, damit die Gläubigen wussten, vor wem sie sich zu fürchten hatten. Die Unholde hießen Luis Buñuel und Jess Franco. Alles richtig gemacht, mag sich Pere Portabella dabei gedacht haben. In Spanien paktierte die katholische Kirche mit der Diktatur, und wer von ihr zum Feind erklärt wurde war ein potentieller Verbündeter. 1961 hatte Portabella Buñuels Skandalfim Viridiana produziert, und 1969 hatte er mit Cuadecuc Vampir parallel zu Jess Francos Nachts, wenn Dracula erwacht einen eigenen, subversiven Film gegen den Diktator gedreht, mit dem die Amtskirche in seinem Land im Bett lag.
Bei dieser Vorgeschichte braucht man sich nicht zu wundern, dass Portabella nach dem Tod des Generalísimo Francisco Franco die Gelegenheit ergriff und mit einem Kamerateam aufbrach, um das Bett des Diktators zu inspizieren. Das geschieht im Film Informe general, von dem Portabella sagt, dass er die Öffentlichkeit mit Meinungen und Informationen versorgen sollte, die in den Jahrzehnten der Franco-Diktatur von den Massenmedien völlig ferngehalten worden waren. In Informe general wird viel geredet, und zwischen den Diskussionsrunden gibt es Bilder, die mehr sagen als tausend Worte.
Von Buñuel stammt der berühmte Satz, dass er dem Zuschauer das Gefühl geben wolle, nicht in der besten aller möglichen Welten zu leben. Das könnte auch von Portabella sein. In Informe general zeigt er uns das Schlafzimmer des Diktators, der sich am liebsten Caudillo de España nennen ließ, Oberhaupt von Spanien. Irgendetwas stimmt da nicht. Es ist das Kruzifix über den Ehebetten. Dieses Kreuz ist nicht das Symbol des Christentums sondern einer politisch instrumentalisierten Religion, die der Macht diente und nicht der Nächstenliebe. In Portabellas avantgardistischen Vampirfilmen ist das Kruzifix denn auch nur Bühnenzauber und kein Schutz vor Monstern.
Abendessen beim Diktator
Ein paar Jahre vor Informe general war der Protzpalast des Caudillo für einen wie Portabella noch fest verschlossen. Aber Jonathan Harker in die Burg von Graf Dracula zu schicken, das ging, weil Jess Franco nichts dagegen hatte, dass Portabella die Dreharbeiten zu El conde Drácula (Nachts, wenn Dracula erwacht) mit der eigenen, von Manel Esteban bedienten Kamera begleitete. Im Roman von Bram Stoker wird Dracula im Lauf der Handlung immer jünger, vitalisiert durch frisches Blut. Im Film von Jess Franco ist das eines der werkgetreuen Elemente, die Harry Alan Towers, der Produzent, seinem Star Christopher Lee versprochen hatte, und somit auch in Cuadecuc.
Am Anfang sieht der Graf so alt aus wie Jess Francos Namensvetter, der Spanien regierte wie ein Feudalherr früherer Jahrhunderte. Der Caudillo feierte seinen 76. Geburtstag, als die beiden Filme gedreht wurden. Wie Dracula residierte er in einem Schloss. Das Essen war für ihn kein Vergnügen, weil er unter einem blutenden Magengeschwür litt (ein paar Jahre später wurde ihm der Magen entfernt). Wie das wohl gewesen wäre, ein Abendessen mit dem Diktator in seinem Palast? So wie in Cuadecuc vielleicht?
Abendessen beim Diktator (14 Bilder)

Harker sitzt an einer Tafel im Kaminzimmer und nimmt ein Nachtmahl ein. Mit am Tisch sitzt ein alter Mann und schaut ihm zu. Der Greis isst selber nichts, fletscht aber hin und wieder die Raubtierzähne, weil er ein Vampir ist. Seine Gefährlichkeit blitzt kurz auf, als ein Bild aus Harkers Brieftasche fällt. Beim Anblick der jungen Frau kann der Vampir seine Gier kaum zügeln. In Nachts, wenn Dracula erwacht ist es ein Photo; in Cuadecuc ein Bewegtbild in Form eines Medaillons. Soledad Miranda als Lucy wird auf die Kamera aufmerksam, lächelt und nickt uns freundlich zu.
Das dient wieder der Illusionsdurchbrechung. Zugleich macht es den Vampir monströser, weil wir keine zur Photographie erstarrte Lucy sehen, sondern eine sehr lebendige junge Frau. Dracula ist das Ungeheuer, das anderen das Leben aussaugt, um das eigene zu verlängern. Für viele Spanier dürfte das den Franquismus recht gut getroffen haben. Spanien war für sie ein graues Land mit einem Herrscher, der sich - metaphorisch gesprochen - vom Blut seiner Untertanen ernährte, parasitär in einem Schloss wohnte und offenbar nicht sterben wollte.
In den letzten Jahren seiner Regentschaft war Franco ein sehr alter und sehr kranker Mann. Seine Umgebung tat alles, um seinen Tod so lange wie irgend möglich hinauszuzögern, weil seine Anhänger Veränderungen fürchteten, die sich mit einem lebendigen Patriarchen besser abwehren ließen. Seine Diktatorenexistenz beendete er als lebender Leichnam. Obwohl keine Gehirnaktivitäten mehr feststellbar waren ließ man sich sehr viel Zeit, ihn für tot zu erklären. Die Beisetzung in der unterirdischen Basilika im Tal der Gefallenen, diesem riesigen Massengrab, war eigentlich kein schlechter Abschluss für ein Gespensterleben.
Totenkult
Nachdem Francisco Franco im November 1975 doch noch gestorben war setzte Portabella die Geschichte fort, mit Informe general. Erst nehmen wir die Grabplatte in der Gruselkirche im Valle de los Caídos in Augenschein und vergewissern uns, dass die Beisetzung des Diktators keine Illusion war. Dann nimmt uns der katalanische Schauspieler Francesc Lucchetti mit auf eine Besichtigungstour durch das Vampirschloss. Durch eine Parkanlage geht es zum Palast El Pardo, Francos Wohnsitz. Am Eingang wartet ein livrierter Diener, macht das Tor auf und zeigt Lucchetti, wie man zu den Gemächern des Verstorbenen kommt.
Der Palast ist menschenleer. Das kennt man von den Vampiren, jedenfalls bei Tag. In Stokers Roman streift Harker durch Draculas Schloss, ohne jemandem zu begegnen. Was er stattdessen findet ist ein Haufen Geld: Münzen aus aller Herren Länder, mit einer Staubschicht überzogen, als würden sie da schon länger herumliegen. Lucchetti stößt auf die Insignien der Macht und auf den Prunk, mit dem sich der Diktator in seiner Residenz umgab. Alles ist mit Repräsentationsmöbeln und anderem Zeug zugestellt, als habe der Mann an einem Horror vacui gelitten.
Totenkult (22 Bilder)

Irgendwo muss die im Bürgerkrieg erbeutete Raubkunst sein, mit der Franco den Palast ausstaffieren ließ. In beleuchteten Vitrinen sind Paradeuniformen ausgestellt, und auch das schon erwähnte Schlafzimmer dürfen wir besichtigen. Wie verbrachte er also die Nacht, der Generalísimo? In einem pompösen Ehebett, wie es scheint. Von der Operettenhaftigkeit darf man sich nicht täuschen lassen. Hier schlief ein Putschist und Kriegsverbrecher. Damit man das nicht vergisst besucht Portabella die Ruinenstadt Belchite. Der Ort war 1937 Schauplatz eines blutigen Häuserkampfes und wurde fast vollständig zerstört.
Auf Anordnung des Caudillo ließ man die Ruinen stehen, um an die Schlacht von Belchite zu erinnern. Allerdings sollte die zerstörte Stadt weniger zum Frieden mahnen als vielmehr ein Denkmal für die rund 7.000 Nationalisten sein, die den Ort bis zum letzten Mann verteidigten, was den Fortgang des Krieges zu Francos Gunsten beeinflusste. Der Faschismus feierte schon immer gern den Opfermut seiner Kämpfer, um andere zu motivieren, ebenfalls für irgendeinen Führer und eine pervertierte Idee vom Vaterland ihr Leben zu geben. Auch bei den Nazis, die halfen, Franco an die Macht zu bomben, stößt man dauernd auf diesen Totenkult.
Republikaner wie Nationalisten kämpften in Belchite mit äußerster Brutalität und Gnadenlosigkeit. Für Portabella ist das kein Ort, an dem man für eine der beiden Seiten Partei ergreift. In Belchite wird Informe general ein paar Minuten lang zum Horrorfilm. Es gibt weder Lucchetti noch sonst einen Menschen, der als Vermittler auftreten könnte. Wir sind allein mit der Kamera, die durch die Ruinen dieser Geisterstadt streift und mit der elektronischen Musik von Carles Santos, die klingt, als sei es dem Komponisten gelungen, das Seufzen der toten Seelen hörbar zu machen.
Henker und Privatmann
In Belchite führt Portabella fort, was er (mit Hilfe von Jess Franco) in Cuadecuc begonnen hat. Vom Vampir magisch angezogen, schlafwandelt Lucy dort durch das Gotische Viertel von Barcelona. Mina folgt ihr. Jess Franco - in seiner Rolle als Faktotum im Irrenhaus - bekreuzigt sich. In Nachts, wenn Dracula erwacht ist das recht atmosphärisch. In Cuadecuc ist es gespenstisch. Wir sind im Reich der Phantome (Jess Franco und seine Filmcrew inklusive). Es ist, als wären wir in eine andere Dimension geraten, und doch bleiben wir immer im Spanien des Diktators - in einem Land, in dem die Zeit stehengeblieben schien, seit der Caudillo an der Macht war.
Dracula ist der Untote, der seinen Opfern erst den freien Willen raubt, um sie dann auszusaugen. Nachdem er seinen Durst gestillt hat bettet er sich zur Ruhe. Lee steigt, ein wenig Kunstblut an den Lippen, in den Sarkophag mit "seinem" Namen (Dracula) und wird mit künstlichen Spinnweben überzogen. Dann macht jemand den Deckel zu. Wenn man das gedanklich mit dem Schlafzimmer im Pardo-Palast verbindet erhält man die zwei Seiten einer Doppelgängerexistenz. Auf der einen, der Tagseite, gibt es den würdevollen Patriarchen und den Chef eines Staates, der in die EU will (bestimmt kommt täglich die Putzkolonne, um im Palast Staub und Spinnweben zu entfernen).
Henker und Privatmann (23 Bilder)

Auf der Nachtseite treibt das Monster aus der Gruft des Horrorfilms sein Unwesen. Bevor Lee in den Sarkophag steigt greift er plötzlich nach der Kamera wie nach einem lästigen Insekt. Zugleich ist er der nette Opa, der für uns Kinder den Vampir spielt. In einer Drehpause geht er zu Vogelgezwitscher durch den Wald, winkt der Kamera freundlich zu und nimmt die Sonnenbrille für uns ab. Solche Momente, in denen gegen die Sehgewohnheiten verstoßen und die stillschweigende Übereinkunft aufgehoben wird, dass die Schauspieler von der Existenz der Kamera und des Publikums nichts wissen, gehören zu den beunruhigendsten des Films.
Eigentlich ist nichts Bedrohliches daran, wenn wir Christopher Lee als ihn selbst sehen, nicht als Graf Dracula. Unheimlich ist es trotzdem. Hier zahlt sich Portabellas Strategie aus, die Grenzen zwischen Schauspieler und Rolle zu verwischen, zwischen Spielfilm und dokumentarischem Making of. Wenn Christopher Lee lacht und in die Kamera winkt, schreibt Rosalind Galt in einem lesenswerten Text über die Barcelona-Schule, dann sei das wie eine dieser Wochenschau-Aufnahmen von Diktatoren, die sich daheim entspannen und den jovialen Patriarchen herauskehren, obwohl sie Henker sind.
Galt beschreibt ein Paradoxon: Durch die Filmaufnahmen vom Diktator privat wird die politische Gewalt unsichtbar gemacht, und sie scheint umso stärker durch, je unsichtbarer sie geworden ist. Ob das auch gilt, wenn deutsche TV-Historiker Hitler auf dem Obersalzberg zeigen, um Geschichte als Tütensuppe aufzubereiten, weiß ich nicht genau. Bei Portabella klappt es gut. Das hat damit zu tun, dass die Gewalt, ob sichtbar oder unsichtbar, aus den genreüblichen Zusammenhängen des Horrorfilms gelöst und deshalb frei anschließbar ist.
Beim Vampirfilm lässt sich trefflich darüber diskutieren, was die Pfählung zu bedeuten hat. Schlägt das Patriarchat zurück, indem es einen phallischen Pflock in den Körper der Frauen rammt, deren Sexualität durch Draculas Biss erwacht ist? Fragen wie diese laufen bei Cuadecuc ins Leere, weil die Gewalt nicht als die Trägerin bestimmter Botschaften fungiert. Die Gewalt ist die Botschaft. Draculas Schatten legt sich auf eine Gesellschaft, in der niemand sicher ist. Einmal steht Dracula in seinem Schloss. Harker liegt neben ihm auf dem Boden und ist ihm schutzlos ausgeliefert. Das ist das Bild dafür.
Tod den Vampiren
Soledad Miranda schreitet als Vampirin durch die Nacht, als würde sie den Boden kaum berühren, dreht sich um und lächelt uns an. Für Fans der als Kultfigur verehrten Soledad ist Cuadecuc ein Muss. Lounge-Musik umschmeichelt eine Schminkszene, aber das ist nur die Vorbereitung auf die Pfählung, vorgenommen von drei Männern an einer Frau hinter Gittern. Jack Taylor als Lucys Verlobter inspiziert fast zärtlich den Sarg, bevor er die zierliche Soledad hineinhebt. Dann kommt Herbert Lom mit Pfahl und Hammer. Alles nur gespielt, könnte man sich erleichtert sagen, wenn Cuadecuc nicht ein Film der harten Kontraste wäre.
Hier ist es der Kontrast zwischen Schminken und Zuschlagen, zwischen Zärtlichkeit und Brutalität, zwischen Lounge-Musik und Synthesizer-Hämmern, der das Pfählen nur noch schlimmer macht. Nach Van Helsing tritt der Verlobte an den Sarg, um Lucy mit einem Spaten die Kehle zu durchtrennen. Die Männer sehen erschöpft aus, nach vollbrachter Tat. Ob sich so die Folterknechte fühlen, die in Umbracle den Mann auf dem Gehsteig in ein Auto zerren? Ohne Dialoge kann keiner über die Pflichterfüllung reden, über die Abwehr von Gefahren, den Dienst am Vaterland. Die üblichen Begründungen fallen weg. Was bleibt, ist die Gewalt.
Tod den Vampiren (1) (22 Bilder)

Lucys zweiter Tod, dieses Mal als Vampirin, wird mit Friedhofsbildern eingeleitet, mit Grabsteinen für die Verstorbenen. Wenn Van Helsing und seine Helfer ihre Arbeit getan haben sieht man Grashalme am Rande eines Feldwegs. Vielleicht wächst das Gras auf einem der Massengräber aus der Zeit des Bürgerkriegs, die bis heute nicht geöffnet sind. Die Opfer zu bergen, zu identifizieren und ordentlich zu bestatten, damit die Angehörigen wenigstens einen Platz haben, an dem sie trauern und sich erinnern können, ist eine alte Forderung, die lange ignoriert wurde. Im neuen Jahrtausend ging man die Aufgabe endlich an, meistens auf Initiative von Privatleuten. Das offizielle Spanien bleibt sehr zögerlich.
Vollends zum surrealen Albtraum wird die Pfählung von Draculas Bräuten. Die Mischung aus Vampirdrama und "Behind the scenes" distanziert nicht, sie betont den industriellen und geschäftsmäßigen Charakter des Geschehens. Carles Santos liefert retardierende Klangeffekte dazu, die sich anhören, als sei noch vor dem ersten ganzen Ton die Platte hängen geblieben. Man fühlt sich als Gefangener einer Endlosschleife, was das Fluchtbedürfnis nur verstärkt. Maria Rohm steht in ihrem Produzentengattinnenoutfit dabei, als hätte sie sich von einer Schickeriasendung des Boulevardfernsehens hierher verirrt. Das macht die Seh- und Hörerfahrung nicht angenehmer.
Tod den Vampiren (2) (30 Bilder)

Wenn das Ganze vorbei ist nimmt Christopher Lee die Kontaktlinsen heraus und hält die Vampiraugen (bei Jess Franco sind sie rot) grinsend in die Kamera. Das ist einer der Buñuel-Momente in Cuadecuc (man vergleiche das zerschnittene Auge in Der andalusische Hund). Einen anderen, den Buñuel’schen Schuh-Fetischismus, bescheren uns Maria Rohm und eine der Vampirinnen. Die Braut ist bei der Pfählung barfuss, schlüpft auf dem Weg zum Sarg aber rasch in ein Paar Pumps, ehe Rohm autoerotisch ihre Glitzerbeine streichelt und uns die Kamera die Schuhe zeigt, in denen diese stecken.
Cuadecuc endet mit den beiden einzigen Takes mit Direktton. Christopher Lee sitzt in einer Garderobe und wundert sich darüber, wie kurz Draculas Tod in Bram Stokers Roman abgehandelt wird. Dann liest er vor, wie die Vampirjäger den Grafen zur Strecke bringen. "Cut!" ruft Portabella im Off und der Film ist aus. Das ist der ziemlich unverhohlene Wunsch, dass der Diktator endlich sterben möge. Fünf Jahre später, 1975, war es soweit und Portabella konnte mit der Arbeit an Informe general beginnen, seiner Bestandsaufnahme aus einer Zwischenwelt: einer Reflektion über Spanien zwischen Franco-Diktatur und Demokratie.
Drachen und Schattengewächse
Lee konnte ziemlich unleidlich werden, wenn er sich in seiner Würde als Schauspieler verletzt fühlte. Bei seinen Szenen in Nachts, wenn Dracula erwacht durfte - auf Kosten des restlichen Films - nicht gespart werden, weil Towers Lee eine finanziell gut ausgestattete Produktion versprochen hatte, keinen mit seinem Namen spekulierenden Billigfilm. Ein weiterer von Towers ausgeworfener Köder war der, dass er direkt aus dem Roman übernommene Sätze sprechen durfte, und sogar mehrere hintereinander. Bei den Hammer-Draculas ärgerte er sich permanent darüber, dass er weniger zu sagen hatte als Johnny Weissmüller in den Tarzan-Filmen.
Man fragt sich, wie seine erste Reaktion war, als er erfuhr, dass er in Cuadecuc - abgesehen vom Schluss - gar nicht mehr zu hören sein würde. Jedenfalls scheint er sich mit Portabella gut verstanden zu haben. Er war sogar bereit, einen weiteren Film mit ihm zu drehen. Im Spanien des ewigen Caudillo war das schon ein politischer Akt. Am Anfang von Umbracle besucht Lee das Zoologische Museum. Dr. Pretorius aus Bride of Frankenstein könnte hier die Gläser mit seinen Homunculi abgestellt haben, aber es geht doch mehr um die Tierpräparate und um den Akt des Sehens als Mittel der Gewaltausübung. Umbracle ist Portabellas Meditation über Psycho, mit Graf Dracula als Franco-Double in einer Gastrolle.
Drachen und Schattengewächse (25 Bilder)

Hitchcocks Norman Bates hat zwei Hobbys, den Voyeurismus und die Taxidermie. Bei Portabella beobachten wir Christopher Lee dabei, wie er durch die Reihen mit den Vitrinen geht und die Exponate betrachtet, zu gespenstischer Musik von Carles Santos, die klingt, als habe er mehrere Frauenstimmen gemischt und elektronisch verfremdet - passend zu den Bildern, die aussehen wie durch Gaze gefilmt, oder durch ein Leichentuch. Wir beobachten auch einen Museumswärter dabei, wie er Christopher Lee beobachtet, und unterdessen beobachtet Lee einen Präparator dabei, wie er einen ausgestopften Reiher in den Schaukasten mit den Störchen und den Flamingos stellt, damit ihn die Besucher dort sehen können.
Das ist die Einführung in eine Überwachungswelt, in der alles kategorisiert ist und man nie wissen kann, wer einen gerade beobachtet. Vielleicht kam Portabella die Idee zu Umbracle, als Jess Franco die Szene drehte, in der Dracula in Lucys Schlafzimmer eindringt und ihr das Leben aus dem Körper saugt. Soledad Miranda sieht da aus wie Marion Crane nach dem Duschmord. Könnte das Tier, das der Präparator bringt, ein Kranich sein? Crane ist das englische Wort für diesen Vogel; als Verb gebraucht bedeutet es: den Hals recken (damit man besser sehen kann).
Norman spricht von grausamen Augen, die einen beobachten, bevor er Marion ersticht und ihr Kopf mit nun toten, weit aufgerissenen Augen auf dem Boden liegt. Sie ist jetzt einer von seinen Vögeln und sieht nichts mehr. Aber was ist das für ein seltsamer Titel? Umbracle. Das Wort ist abgeleitet vom lateinischen umbraculum und wäre in etwa mit "Schattengang" oder "Schattenhaus" zu übersetzen. Mit seinem Glasdach und der Lamellenkonstruktion zur Filterung des Lichts könnte das Umbracle von Barcelona, das Portabellas Film den Titel gab, fast ein frühes Atelier sein wie jenes, das sich der Kinomagier Georges Méliès in Montreuil baute.
Errichtet von 1883 bis 1887 im Parc de la Ciutadella, dem zentralen Ort der Weltausstellung von 1888, ist das Umbracle das ideale Gewächshaus für Pflanzen, die den Schatten der Baumriesen in tropischen und subtropischen Urwäldern lieben. Der "Zitadellenpark" ist nach der riesigen Festung benannt, die Philipp V. dort bauen ließ, um das im spanischen Erbfolgekrieg eroberte Barcelona zu kontrollieren und zu unterjochen. Als Haus der Schatten ist das Umbracle also nicht nur ein geeigneter Platz für den lichtscheuen Vampir; für die Bewohner Barcelonas ist es auch, durch seine Lage im Parc de la Ciutadella, mit dieser alten Zitadelle assoziiert, dem Symbol der verhassten Zentralregierung in Madrid.
Ebenfalls für die Weltausstellung im Zitadellenpark errichtet wurde das Castell dels Tres Dragons, ein Wahrzeichen des katalanischen Jugendstils und für die Katalanen ein wichtiger Ausdruck ihrer kulturellen Identität, die Franco am liebsten ausgemerzt hätte, weil er in seinem Zentralstaat keine kulturelle Vielfalt wollte. Als Christopher Lee durch die "Burg der drei Drachen" ging beherbergte das Gebäude noch das Zoologische Museum von Barcelona. Durch die Wahl des Drehorts gab Portabella ein politisches Statement ab, und ein Bekenntnis zur Kultur der Katalanen. Originalschauplätze erzählen ihre eigene Geschichte. Als Filmemacher kann man das nutzen - beispielsweise zum Unterlaufen der Zensur.
Herrschaft des Unrechts
Nach dem Museumsbesuch wird Lee Zeuge der schon erwähnten Entführung (siehe Teil 1). Ein Mann wird in ein Auto gezerrt und weggebracht. In Psycho versinkt das Auto mit der Leiche von Marion Crane im Sumpf. Der Wagen in Umbracle bringt den verschleppten Mann in einen der Kerker des Regimes. Dazu läutet dauernd das Telefon. Ist der Anrufer ein Freund, der den Mann warnen wollte und ihn nicht mehr erreichte? Will jemand die Polizei alarmieren? Niemand nimmt den Hörer ab in einem Land, in dem die Polizisten die Entführer sind. Hilfe gibt es nicht in einem Willkürstaat wie diesem.
In Informe general wird die Autofahrt fortgesetzt. Wir sind wieder in Barcelona. Früher Morgen. Auf dem Rücksitz haben Magda Oranich und Marc Palmes Platz genommen, die Verteidiger von Juan Paredes, genannt "Txiqui". Txiqui war ein militantes Mitglied der ETA. Nach einem Banküberfall wurde er im September 1975 von einem Militärgericht in einem Eilverfahren zum Tode verurteilt. Grundlage waren im August verabschiedete Anti-Terror-Gesetze, die von internationalen Organisationen als Verstoß gegen die Menschenwürde gebrandmarkt wurden. Die Anwälte erklären Txiqui nicht zum Unschuldsengel. Sie berichten von einem Mandanten, dem ein rechtsstaatliches Verfahren verweigert wurde.
Herrschaft des Unrecht (15 Bilder)

Im Laufe der Fahrt wird klar, dass das Auto auf denselben Straßen unterwegs ist, auf denen damals ein kleiner Konvoi fuhr, um zur Hinrichtungsstätte zu gelangen - gleich neben dem Friedhof, in dem der Leichnam anschließend verscharrt wurde. Dort angekommen, zeigen die Anwälte die Stelle, an der ihr Mandant von einem aus Geheimpolizisten bestehenden Erschießungskommando getötet wurde, eine Woche nach der Verhandlung, auf die sich die Verteidigung vier Stunden lang vorbereiten konnte. Der Horror der Diktatur wird da sehr real. Am Schauplatz des Justizmordes hat jemand einen Stacheldrahtzaun errichtet, als solle man am Betreten einer Vergangenheit gehindert werden, die man besser schnell vergisst.
Juan Paredes war einer von fünf militanten Franco-Gegnern, die am 27. September trotz internationaler Proteste hingerichtet wurden, nachdem sie Militärtribunale unter Umgehung rechtsstaatlicher Prinzipien verurteilt hatten. Im Oktober versuchten Costa-Gavras und Yves Montand, zwei Protagonisten des politisch engagierten Films (Z, Das Geständnis, Der unsichtbare Aufstand), in Madrid gegen den franquistischen Unrechtsstaat zu demonstrieren; sie wurden von der Polizei daran gehindert und ausgewiesen. Weitere Exekutionen wurden erwartet. Die Rede war von einer Todesliste mit 27 Namen.
Am 20. November starb Francisco Franco. Das Ende des Diktators war gleichbedeutend mit dem Ende der Todesstrafe. Das war tatsächlich so ähnlich wie in Stokers Dracula-Roman. Da wird nach Lucy auch Mina allmählich zur Vampirin. Nach Draculas Tod ist sie geheilt. Eine Existenz als Untote und als versklavte Braut eines übermächtigen, seinen Untertanen das Blut aussaugenden Patriarchen bleibt ihr erspart. Die schreckliche Autofahrt in Informe general vergisst man nicht so leicht. Das Läuten des Telefons zur Verschleppungsszene in Umbracle ist quälend. Die ganz dokumentarisch gehaltene Autofahrt ist noch schlimmer.
Gott kämpft mit den Faschisten
In einer nachgestellten Szene in Informe general dringt die Geheimpolizei in eine Wohnung ein, in der Franco-Gegner Flugblätter drucken. Das ist der Überfall eines Schlägertrupps, der andere Leute demütigen will. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das wieder nichts zu tun. Über die Bilder von der Polizeibrutalität legt Portabella Texte mit einzelnen Artikeln aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Was wir sehen sind Verstöße gegen die dort niedergeschriebenen Prinzipien. Zu den Artikeln 5 (Verbot der Folter) und 10 (Anspruch auf rechtliches Gehör) wird gefoltert und geschlagen. Gehör findet man höchstens beim Chef der Geheimpolizisten.
Ein Text weist auf die internationalen Pakte über bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hin, die am 16. Dezember 1966 in zwei Resolutionen der Vollversammlung der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet wurden, auch von Spanien. Mit diesen beiden Pakten (abgekürzt: IPBPR und IPWSKR) stellte die UNO die Erklärung von 1948 auf eine neue rechtliche Basis, zumindest theoretisch. In der Praxis, im Spanien der Franco-Diktatur, wird der von Francesc Lucchetti gespielte Aktivist einer Vorform des Waterboarding unterzogen.
Gott kämpft mit den Faschisten (Informe general) (25 Bilder)
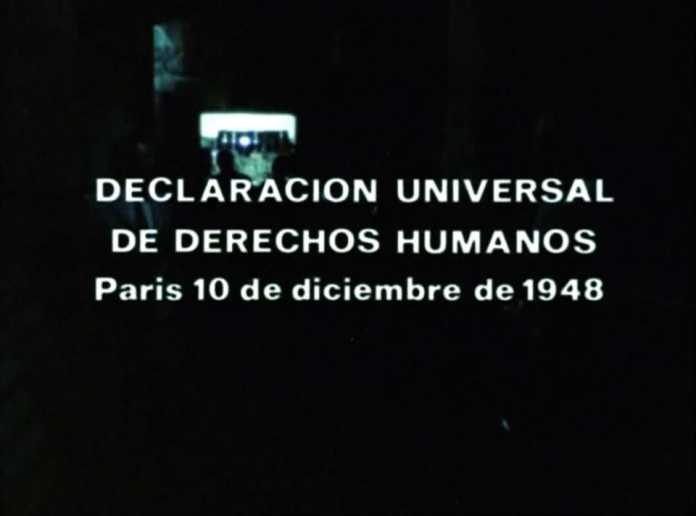
In der nächsten Szene holt Lucchetti die Rollen mit Raza aus dem Archiv, dem 1940 von Francos Schwager gedrehten Propagandafilm. Raza, sagt Lucchetti, stehe exemplarisch für die neue spanische Gesellschaft, die nach dem mit Francos Sieg endenden Bürgerkrieg entstanden sei. Dann sehen wir eine von Portabella montierte Kurzfassung über den aufopferungsvollen Kampf der christlichen Familie, der katholischen Kirche, der uniformierten Gesellschaft und der ihren Feinden überlegenen Rasse gegen - so der Film - die Dekadenz der Volksfront und der Kommunisten, die Spaniens Traditionen zerstören und das Land in einen Abgrund an Barbarei führen würden, wenn da nicht der Faschismus wäre.
Nach dem Sieg der Faschisten über Demokratie und Republik küsst sich das durch die Kommunisten getrennte und nun wieder vereinte Liebespaar, bei Paraden wird ausgiebig marschiert, und schon die kleinen Kinder tragen Uniform, weil das der Aufbruch in eine neue Zeit ist, wie es bei den Nazis hieß, in Hitlerjunge Quex. Durch den Zusammenschnitt wird deutlich, warum sich Portabella nicht für konventionell erzählte Geschichten interessiert. Man muss andere, die geistige Aktivität des Publikums stimulierende Formen finden, um der gehirnerweichenden Kraft der Kinopropaganda zu begegnen.
Daneben muss man die Propaganda als solche entlarven wo man kann. In Umbracle schneidet Portabella Schlüsselszenen aus El frente infinito hintereinander, einem Bürgerkriegsdrama von Pedro Lazaga aus dem Jahr 1959, in dem das Hohelied auf den ewigen Marsch des Faschismus gegen die Mächte des Bösen gesungen wird. Am Anfang redet ein Offizier einem feigen Militärpfarrer ins Gewissen und macht ihm klar, dass das auch sein Krieg ist (in dem die Kommunisten mit Geschützen auf Krankenhäuser schießen). Dann erleben wir mit, wie die katholische Kirche in einer geschlossenen Schlachtreihe mit den Faschisten gegen die Republikaner kämpft, und wir erfahren, dass Gott auf Seiten Francos steht.
Gott kämpft mit den Faschisten (Umbracle) (24 Bilder)

Nachdem ihn - im Vertrauen auf Gott und den Franquismus zum Helden geworden - das Geschützfeuer der Republikaner nicht am Segnen der Hostie hindern konnte und die Guten zum Gegenangriff übergegangen sind greift sich Hochwürden das Gewehr eines gefallenen Soldaten. Das Kreuz wird politisch instrumentalisiert und so zu einer Waffe, die nicht das Heil, sondern den Tod und die Unterdrückung von Andersdenkenden bringt. Portabella kommentiert das mit Hilfe von Christopher Lee. In seiner Funktion als Franco-Ersatz macht Lee einen Ausflug auf einen Berg, in hochkontrastigen Bildern wie in Cuadecuc. Das könnte im Tal der Gefallenen sein oder in der Gegend, in der Lazaga den Bürgerkrieg inszenierte.
Lee setzt sich - mehr schemenhaftes Wesen aus einer Zwischenwelt denn Mensch aus Fleisch und Blut - auf einen Felsen, nimmt die Sonnenbrille ("Franco privat") ab und liest ein Buch. Die Vögel singen. Ein junger Mann in einer Mönchskutte kommt dazu. Der Mönch sieht Lee zuerst nur von hinten und erschrickt. Lee dreht sich um. Voller Angst rennt der Mönch davon. Lee blickt ihm nach und entdeckt die Bibel, die der Mann in seiner Angst fallengelassen hat. Er hebt sie auf, lächelt und legt sein eigenes Buch darüber: Bram Stokers Dracula. Bibel, Kreuz, Hostie und Weihwasser, die traditionellen Abwehrmittel des Christentums, heißt das, haben ihre Macht über den Vampir längst verloren.
Die katholische Kirche, sagt Umbracle, ist in einer Illusion gefangen, wenn sie glaubt, dass sie das Schreckgespenst, mit dem sie sich zur Erhaltung ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihres Grundbesitzes und ihrer Privilegien ins Bett gelegt hat, lenken und kontrollieren kann. Dracula gibt den Ton an und nicht die kirchlichen Würdenträger, die sich an ihn verkauft haben. Im Nachhinein wirkt die Einstellung mit dem hämisch lächelnden Christopher Lee wie die vorweggenommene Reaktion auf Papst Paul VI., der im September 1975 an Francos Christentum appellierte und ihn bat, Txiqui und die anderen Verurteilten zu begnadigen. Der Diktator hörte gar nicht hin.
Nevermore
Einmal wendet sich Christopher Lee "direkt" an die Kamera (asynchron; mal von vorne, mal von hinten und mal von der Seite) und kündigt an, dass er jetzt für sich selbst sprechen und etwas tun werde, das nicht im Drehbuch steht und das der Regisseur nicht vorbereitet hat. Er werde ein Lied singen, weil er die Musik liebe und weil er ein Sänger sei und weil er das noch nie gemacht habe in einem Film. Dann bringt er auf einer Bühne eines leeren Theaters zwei Opernarien zu Gehör, aus Richard Wagners Der fliegende Holländer und aus Fausts Verdammnis von Hector Berlioz. Anschließend trägt er "The Raven" vor, das berühmte Gedicht von Edgar Allan Poe.
Man könnte meinen, dass Portabella Lee erlaubte, zwischendurch seinen Hobbys zu frönen, um den Star, der vermutlich ohne Gage mit ihm arbeitete, bei Laune zu halten. Da täuscht man sich. Umbracle ist sorgfältig durchdacht und konstruiert; nur eben anders als gewohnt. Die Lieddarbietungen folgen einem ästhetischen Konzept der Befreiung von gängigen Erzählschemata und der Rückkehr zum Kino der Attraktionen aus der Frühzeit der Kinematographie, als sich Filme noch an den Nummernrevuen der Varietés und der Vaudevilles orientierten, nicht an der Abgeschlossenheit bürgerlicher Kunstformen.
Nevermore (19 Bilder)

Vor der Gedichtrezitation erklärt uns Lee, was er an "The Raven" (Der Rabe) für so bemerkenswert hält. Ein Mann hört ein Klopfen am Fenster, öffnet es und herein stolziert ein Rabe, der sich auf einer Büste im Zimmer des Mannes niederlässt. Der Mann beginnt, mit dem Vogel zu reden und merkt, dass der Rabe nur ein Wort sagen kann: "Nevermore". Dieses Wort lässt den Mann immer verzweifelter werden. Ganz egal, welche für ihn sehr wichtige Fragen er stellt, über seine verlorene Liebe, über sein Leben, über seine Zukunft, der Rabe antwortet immer nur mit "Nevermore".
Er wisse von keinem anderen Gedicht, sagt Lee, in keiner der ihm bekannten Sprachen - nach deutsch (Wagner) und französisch (Berlioz) sind wir jetzt bei englisch -, wo sich das gesamte Werk um ein einziges Wort drehe: "Nevermore". Man sitzt einsam in einem Zimmer und begreift mit zunehmender Hysterie, dass der Todesvogel, mit dem man konfrontiert ist, auf alle für einen selbst existentiellen Fragen nur eine Antwort kennt: Nein. Nimmermehr. Nie wieder. Das ist doch eigentlich eine sehr zutreffende Beschreibung der Gefühlslage vieler Spanier, die sich in ihrem Land wie in einem Gefängnis fühlten und mit wachsender Verzweiflung darauf warteten, dass der zu allem Nein sagende Diktator endlich sterben möge.
Am Schluss kommt Portabella sogar ein Missverständnis zugute, wie zur Bestätigung der von ihm gewählten Vorgehensweise. Nach seiner Einführung weist Lee darauf hin, dass die Kamera weiter läuft, obwohl abgesprochen war, die Gedichtrezitation in einem eigenen Take zu drehen. "Cut! Cut!", ruft Portabella. Schnitt. Lee trägt das (gekürzte) Gedicht vor. Jetzt ist aber zu wenig Film in der Kamera, weil sie zuvor zu lange weitergelaufen ist. Das letzte "Nevermore" des Gedichts gibt es nur auf der Tonspur, nicht im Bild. Also wird eine neue Filmrolle eingelegt.
Lee wiederholt das letzte Wort des Gedichts und das einzige Wort, das für den greisen, zu seinem eigenen Standbild erstarrten und jeden (politischen) Fortschritt ablehnenden Diktator relevant war. Nur dieses eine Wort: "Nevermore". Besser hätte man die Negativität des Franco-Regimes nicht herausstellen können. Bevor die alte Filmrolle zu Ende war haben wir noch von den dämonischen Augen des Raben gehört, der auf der Büste sitzt wie auf einem Thron und seinen Schatten auf die Seele des Erzählers wirft. Jetzt starrt Christopher Lee in die Kamera. Mehr als eine halbe Minute lang, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. Gruselig. In diesem Zimmer mit dem Raben will man ganz bestimmt nicht sein.
Mit einem Vampir im Aufzug
Danach geht Lee wieder ins Zoologische Museum. Dieses Mal kauft er sich sogar eine Eintrittskarte. Man sieht lange Reihen mit Vögeln in Vitrinen; schemenhaft auch das Skelett des Dinosauriers, das im Kastell der drei Drachen ausgestellt war. Bei dieser Gelegenheit könnte man sich an den Glaskasten mit den Rabenvögeln erinnern, an dem Lee bei einem früheren Besuch vorbeiging, bevor er das Museum wieder verließ - mit einem stillen Gruß an Norman Bates vielleicht, den Killer und Präparator, der sich vor den durchdringenden Blicken anderer Lebewesen fürchtet?
Rabenvögel sind die Protagonisten einer berühmten Szene in The Birds, dem mittleren Film in Hitchcocks alphabetisch geordneter Trilogie über Frauen als Opfer einer patriarchalischen Gesellschaft: Marion Crane (MC) in Psycho, Melanie Daniels (MD) in The Birds, Marnie Edgar (ME) in Marnie (und Edgar wie in Edgar Allan Poe). Die Frau in Umbracle ist Jeanine Mestre, eine der gepfählten Vampirbräute in Nachts, wenn Dracula erwacht (und in Cuadecuc). Das erste Mal begegnen wir ihr in Hitchcocks liebstem Fortbewegungsmittel, dem Zug.
Mit einem Vampir im Aufzug (23 Bilder)

Die Frau sitzt allein in einem Abteil (auf Platz 36, 1936 begann der Bürgerkrieg), liest eine Zeitung. Ein Mann kommt herein, setzt sich ihr gegenüber, schaut sie an. Die Frau fühlt sich erkennbar unwohl, wirft hin und wieder einen kurzen Blick auf ihr Gegenüber, aber meistens hält sie die Augen gesenkt, während der Mann sie weiter anschaut. Kein Wort wird gesprochen. Wir hören nur das Rattern des Zuges. So vergehen drei Minuten, in denen weiter nichts passiert und doch so viel. Aus einer an sich alltäglichen Szene - zwei Leute sitzen in einem Zugabteil - wird eine Studie über die Macht der Blicke. Portabella etabliert so eine Atmosphäre von Überwachung und Bedrohung.
In einer späteren Szene betritt die Frau einen Aufzug. Christopher Lee steht schon drin. Dieses Mal schaut der Mann die Frau so betont nicht an, dass es schon wieder auffällig ist. Mestre wirkt durch die Inszenierung klein und eingeengt. Aus dem Augenwinkel blickt sie verstohlen zu Lee, dann wieder weg. Der Aufzug fährt nach oben, Lee geht hinaus, die Frau fährt weiter. Mehr passiert nicht. War der Mann mit der Vampir-Aura zufällig in dem Aufzug oder stand er da, um eine unheimliche Präsenz zu demonstrieren, um der Frau zu zeigen, dass man sie beobachtet?
Die Frage lässt sich so wenig mit Bestimmtheit beantworten wie die, ob der Mann im Zug ein potentieller Vergewaltiger war, ein Geheimpolizist oder ein harmloser Passagier, der keinen Lesestoff dabei hat und ins Leere blickt, der die Frau weniger anschaut als durch sie hindurch. Das Bedrückende daran ist, dass man es nie sicher wissen kann, dass es Sicherheit in einem Unrechtsstaat nicht gibt, obwohl sie von Autokraten versprochen wird. Die Bedrohung ist überall und nirgends. Wer heute ungehindert mit dem Zug von A nach B fährt wird morgen vielleicht schon von der Polizei erwartet und sein Ziel nie erreichen.
Stummer Schrei
In Umbracle dominiert das Gefühl des Gefangenseins, der Klaustrophobie. Kurz vor Schluss kommt die Frau nach Hause. In ihrer Wohnung legt sie eine Schallplatte auf. Wir hören Musik, die Frau geht zum Telefon, will jemanden anrufen. Auf der Tonspur wiederholen sich dieselben paar Noten, als habe die Platte einen Sprung. Einen solchen Sprung hat für Portabella auch das Leben in Francos Spanien. Wir sehen, wie Mestres Hand den Telefonhörer zum Ohr führt, immer wieder. Die Kamera wechselt die Perspektive. Dann geht es von vorne los. Immer wieder. Die andere Hand streckt sich zur Wählscheibe. Dann noch einmal, ehe die Frau eine Nummer wählen kann. Immer wieder.
Poes Gedicht fängt damit an, dass der Erzähler das Klopfen des Raben an Tür und Fenster hört. In Umbracle begleitet das Klopfen eine Szene mit Jeanine Mestre und Christopher Lee. Die beiden sitzen auf einem Sofa und unterhalten sich. Anstelle der Dialoge hören wir (und nicht die Schauspieler) ein Klopfgeräusch. Wer klopft wissen wir so wenig wie wir wissen, wer bei der Entführung den Telefonanruf macht. Aus der Unterhaltung wird ein Streit und daraus - vielleicht - eine Versöhnung. Das Klopfen wird häufiger und insistierender. Die Kamera fährt langsam zurück, zur Zimmertür hinaus, durch einen dunklen Korridor, immer weiter weg vom Paar auf dem Sofa, bis die Szene endet. Das ist enervierend.
Stummer Schrei (23 Bilder)

Dieses Zimmer steht für Francos Spanien. Die Tür ist offen, und doch kann man nicht hinaus. Allenfalls verschwindet man kurz im Off, dann ist man wieder da und sitzt auf diesem Sofa aus einer anderen Zeit. Draußen klopft es und man hört es nicht, so wie man selber nicht gehört wird mit dem, was man zu sagen hat. Für mich erklärt das Portabellas an die Nouvelle Vague erinnernden Hang zum Zitat, zum Verweis auf andere Filmemacher. In einer Diktatur mit vom Regime kontrollierten Massenmedien, die in für ihn wichtigen Bereichen vom Ausland abgeschottet war, stellte er so den Kontakt nach draußen her, zur freien Welt am Ende des dunklen Korridors.
Einer, der seit Jahrzehnten dafür wirbt, mit Pere Portabella einen führenden Vertreter des europäischen Films zu entdecken, ist der amerikanische Kritiker Jonathan Rosenbaum. Nachdem Umbracle 1972 in Cannes gelaufen war (ohne den Regisseur, der nach wie vor keinen Reisepass hatte und Spanien nicht verlassen durfte), schrieb er in der Village Voice, dass Portabella aus der asynchronen Verwendung von Bild und Ton ein Aggressionsinstrument mache, um - vergleichbar mit Hitchcock und Alain Resnais - unsere narrativen Erwartungen zu unterlaufen und uns so in Unruhe zu versetzen.
Das, so Rosenbaum, sei Ausdruck der politischen Frustration, von der Umbracle handele: "Stumme Bilder von einem sich unterhaltenden Paar in einem Wohnzimmer werden von lauten Klopfgeräuschen begleitet, die immer heftiger und gröber werden, bis wir fast zu schreien anfangen, dass jemand an die Tür gehen möge. […] Vorher läutet dauernd das Telefon, und niemand geht an den Apparat; und in der vorletzten Szene, wenn eine Frau eine Schallplatte mit Beethovens ‚Pastorale’ auflegt, bleiben sowohl die Platte wie das Bild hängen - dieselben paar Noten werden endlos wiederholt, und die Finger der Frau strecken sich unablässig nach der Wählscheibe eines Telefons aus, die sie nie erreichen werden."
Vampire, Schlachtvieh und Konsumenten
Portabella, meint Rosenbaum, sei in einer Tretmühle unterwegs, und diese Tretmühle sei das heutige Spanien (also das Spanien von 1969/70, als der Film gedreht wurde und von 1972, als er erstmals gezeigt wurde): ein Land, "dem man nicht entkommen und das man nur durch einen Schrei ausdrücken kann. Umbracle ist, unter Verwendung verschiedener Mittel und Tonalitäten, eine präzise Wiedergabe dieses Schreis." Viel besser kann man es nicht sagen. Als Zufluchtsort bleibt die Konsumwelt. Zur Stabilisierung des Landes wurde 1959 ein "Wirtschaftsstrukturgesetz" verabschiedet, das eine wirtschaftliche Öffnung in die Wege leitete, damit politisch alles bleiben konnte, wie es war.
Nach einer durch die Liberalisierung des internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehrs verursachten Rezession mit Landflucht, hoher Arbeitslosigkeit und starker Arbeitsmigration in das europäische Ausland begann 1962 ein Jahrzehnt des wirtschaftlichen Aufschwungs mit einer Neuausrichtung der spanischen Wirtschaft auf den Export, weniger Restriktionen für den Import von Konsumgütern und einer erhöhten Kaufkraft durch das von den Arbeitsmigranten nach Hause geschickte Geld. Das waren Devisen, durch die sich die Zahlungsbilanz verbesserte, was wiederum Importe erleichterte.
Vampire, Schlachtvieh und Konsumenten (34 Bilder)

Die schöne neue Warenwelt, die den Spaniern versprochen wurde, nimmt Portabella schon in seinem ersten Film aufs Korn. No compteu amb els dits besteht aus 28 Segmenten, die sich in Länge und Formgebung an den Werbespots im Kino und im Fernsehen orientieren, um zu zeigen, wie die Konsumgesellschaft unsere Wahrnehmung verändert. Auch in Portabellas Version von einer Erotikszene in Umbracle dominiert das Materielle. Wir sind im Schlafzimmer angelangt. Jeanine Mestre legt sich nackt ins Bett. Christopher Lee schaut zu. In dieser Szene ist er am vampirhaftesten. Er beugt sich über Mestre, schlägt die Decke zurück, beißt aber nicht in ihren Hals, sondern holt Schmuckstücke aus einer Kommode.
Lee legt Mestre einen Armreif um das Handgelenk, schmückt sie mit Ohrringen, steckt ihr einen Ring an den Finger. Das ist kein Erwecken der weiblichen Sexualität wie im Vampirfilm, sondern die Inbesitznahme des weiblichen Körpers durch Pretiosen, die wie Ketten sind. Erst danach senkt Lee den Kopf, als würde er nun endlich zubeißen. Anschließend fährt die Kamera an dem nackten Frauenkörper entlang, vom Kopf über Rücken, Po und Beine bis zu den Füßen, die in Pumps stecken wie die von Draculas Braut auf dem Weg zur Pfählung, in Cuadecuc.
Vorher haben wir die namenlose Frau in einem Schuhgeschäft gesehen. Portabella macht daraus eine leicht surreal angehauchte Mischung aus Werbefilm und Buñuel’schem Fuß- und Schuhfetischismus. Dazu hören wir eine Coverversion von "Close to You", einem Wohlfühlsong der Carpenters: "Why do birds suddenly appear/Every time you are near?/Just like me, they long to be/Close to you". Später, wenn wieder dieses Lied erklingt, sind wir in einem Schlachthof und sehen dabei zu, wie Hühner getötet und in automatisierten Produktionsschritten zu Supermarktware verarbeitet werden.
Interessanterweise drehten Portabella und der ebenfalls stark vom Surrealismus beeinflusste Fernando Arrabal ziemlich genau zur selben Zeit filmische Auseinandersetzungen mit dem Spanien des Francisco Franco, die das durchschnittene Auge in Buñuels Un chien andalou auf die Spitze treiben, jeweils auf ihre Weise. In Arrabals Viva la muerte forscht ein Junge dem Schicksal seines Vaters nach, der im Bürgerkrieg als Kommunist verschleppt wurde und verschwunden ist (der Titel, "Es lebe der Tod", bezieht sich auf einen berüchtigten Ausspruch von Millán Astray, der mit Franco die spanische Legion gegründet hatte).
Beide, Portabella wie Arrabal, ziehen aus der Machart der franquistischen Propaganda den Schluss, dass man die herkömmlichen Gestaltungsmuster durchbrechen und den Zuschauer aus seiner bequemen Konsumentenhaltung reißen muss, um der Wirklichkeit gerecht zu werden (in Viva la muerte ist es die Wochenschau, die das Publikum indoktriniert). Den Sohn des Verschwundenen plagen groteske, mit Video gedrehte, auf Film übertragene und durch Farbfilter weiter verfremdete Albträume. Arrabal zeigt ein Spanien, in dem die vom Bürgerkrieg hinterlassene Leere mit Sex und Gewalt ausgefüllt wird.
Ein schockierender Höhepunkt von Viva la muerte ist das Schlachten eines Ochsen. Aus der Tötung des Tieres wird ein atavistisch anmutendes Blutritual, bei dem mehr roter Lebenssaft die Leinwand tränkt als in allen Vampirfilmen mit Christopher Lee zusammen. Bei Portabella ist das Töten Teil einer auf Effizienz getrimmten Konsumgesellschaft und ein Blick hinter die Kulissen eines Schlachthofs (so wie Cuadecuc ein Blick hinter die Kulissen eines Dracula-Films ist). In den quälend langen drei Minuten, die Portabella der Verwandlung lebender Tiere in tote Supermarkthühner widmet kann man darüber nachdenken, was einen als braven Konsumenten in einer unfreien Gesellschaft mit diesen Tieren verbindet.
Geister der Vergangenheit
Umbracle endet mit einer Referenz an Alfred Hitchcock. Am Schluss von Psycho sitzt Norman, der Vögel genauso präpariert wie seine Mutter, in einer Zelle. Er ist jetzt "Mrs. Bates" und weiß, dass er beobachtet wird. Wir hören seine/ihre Gedanken. Ich kann doch nur hier sitzen und starren wie einer von Normans ausgestopften Vögeln, denkt "Mrs. Bates". Ich will nur ruhig hier sitzen und nicht einmal die Hand bewegen (auf der eine Fliege gelandet ist). Nicht einmal diese Fliege werde ich totschlagen. Sie sollen zuschauen und sehen, was für eine harmlose Person ich bin. Eine Person, die nicht einmal einer Fliege ein Leid zufügen würde.
Dann starrt uns ein grinsendes, durch Überblendung zum Totenschädel werdendes Gesicht an, das Auto mit der Leiche wird aus dem Sumpf gezogen und der Film ist aus. Am Ende von Umbracle ist die Fliege wieder da. Christopher Lee sitzt vor uns wie "Mrs. Bates" und schlägt sie tot. Wir sehen ihre letzten Zuckungen, während wieder das nun mit Schlachtvieh assoziierte "Close to You" erklingt (ein Wohlfühlsong ist das jetzt nicht mehr) und die Schlusstitel laufen. Zuerst der Titel des Films: Umbracle. Das Spanien des Diktators ist eine Gefängniszelle und ein Schattenhaus, in dem die Monster und Dämonen besonders gut gedeihen.
Geister der Vergangenheit (18 Bilder)

Einer von denen, die in Informe general über das Spanien nach Franco diskutieren ist Felipe González, später der erste sozialistische Regierungschef des Landes. Im Juli 1986, am 50. Jahrestag des Ausbruchs des Bürgerkriegs, meinte González, dass der Krieg längst Geschichte sei und ein Gedenken daher nicht mehr nötig. Die Spanier erfahren gerade wieder, dass das Vergessen und Verdrängen nicht so einfach ist. Bis heute spalten die Geister der Vergangenheit die Gesellschaft.
Bevor Franco exhumiert werden kann muss erst der Streit über den Verbleib der Gebeine beigelegt werden. Danach sieht es momentan nicht aus. 2007 verabschiedete das Parlament ein von der Regierung des sozialistischen Premierministers Zapatero eingebrachtes (und bis zur Ratifizierung reichlich verwässertes) "Gesetz des historischen Andenkens", das dazu beitragen sollte, die von Bürgerkrieg und Diktatur geschlagenen Wunden zu heilen. Verfügt wurde unter anderem das Entfernen franquistischer Symbole an öffentlichen Gebäuden und Plätzen (an solchen der katholischen Kirche nur dann, wenn sie staatliche Subventionen erhalten). Politische Veranstaltungen im Tal der Gefallenen wurden verboten.
Der derzeitige Premierminister Pedro Sánchez versprach als eine der ersten Maßnahmen seiner Minderheitsregierung, Franco aus der Basilika zu entfernen, stieß aber auf den Widerstand der Familie. Um den Weg freizumachen verabschiedete das Parlament im September 2018 einen Zusatzartikel zum "Gesetz des historischen Andenkens", der besagt, dass nur die sterblichen Überreste von Menschen ihre letzte Ruhestätte im Tal der Gefallenen finden dürfen, die als Folge des Bürgerkriegs ihr Leben verloren haben. Der Caudillo ist der einzige von den über 30.000 Toten in diesem Tal, auf den das nicht zutrifft, muss also weg.
Allerdings scheint Sánchez nicht mit dem nächsten Zug der Familie gerechnet zu haben. Sie will, dass der Leichnam in die Krypta der Almudena-Kathedrale überführt wird, wo bereits Francos Tochter liegt, also in das Zentrum von Madrid, wo dann womöglich ein Wallfahrtsort für Rechtsradikale entstehen würde. Sanchez hat angekündigt, das - wiederum unter Berufung auf das Gesetz von 2007 - zu verhindern. Um einen Rechtsstreit mit unbestimmtem Ausgang zu vermeiden soll jetzt die katholische Kirche vermitteln, die schon einige Haken geschlagen hat, weil niemand den Schwarzen Peter haben will. Ausgang offen.
Francos Geist wird auch mit im Gerichtssaal sitzen, wenn Spaniens Justiz den katalanischen Separatisten nächstes Jahr den Prozess macht. Unabhängig davon, wo die Gebeine des Diktators dereinst landen werden: Damit Spanien seinen Frieden mit der Vergangenheit machen kann muss sie nicht bewältigt, aber aufgearbeitet werden. Die geplante Umgestaltung des Valle de los Caídos in einen Ort der Versöhnung bietet die nächste Gelegenheit dazu, auch wenn die versprochene Identifizierung der dort einst anonym verscharrten Leichen neue Verletzungen mit sich bringen wird.
Um die Gespenster zu bannen, das weiß im Grunde jedes Kind, muss man sie benennen, ihre Vergangenheit erforschen und herausfinden, wo sie begraben sind. Zur Vorbereitung empfehle ich die Filme von Pere Portabella, der es durch die kreative Anverwandlung des europäischen Horrorfilms verstanden hat, einen neuen Blick auf das zu werfen, was wir für die Wirklichkeit halten. Portabella zeigt, wie befreiend ein solcher Wechsel der Perspektive sein kann. Gegen Gehirnwäsche und Gefängnisse jeder Art ist das viel wirksamer als Kruzifix, Hostie und Rosenkranz.
Pere Portabella auf DVD:
Das bei Intermedio in einer Box mit sieben DVDs erschiene Gesamtwerk (englische, französische und katalanische Untertitel) ist vergriffen, bei einschlägigen Verkaufsportalen aber gelegentlich noch auffindbar. Eine in Frankreich erhältliche DVD-Box ist mit der von Intermedio weitgehend identisch (auch die Untertitel) und enthält dieselben 22 Filme. Die in den USA bei Severin erschienene Blu-ray-Ausgabe von Jess Francos Count Dracula (Nachts, wenn Dracula erwacht) bietet als Bonus eine zweite Blu-ray mit Cuadecuc Vampir (beide Discs Region A,B,C). Die beste Einzelausgabe von Cuadecuc (DVD und Blu-ray) gibt es bei Second Run in England: mit einem halbstündigen Portabella-Interview, zwei Kurzfilmen des Regisseurs, einer 20-minütigen Würdigung durch William Fowler vom British Film Institute und einem Booklet-Text des Soledad-Miranda-Bewunderers Stanley Schtinter. Bei deutschen Anbietern sucht man Pere Portabella vergeblich. Die hiesige Filmkultur ist ein zartes Pflänzchen, das zu selten gegossen wird.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.