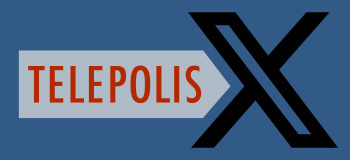Gemeinschaft über alles?
Zur Wiederkehr des Kommunitarismus bei Fragen der Gerechtigkeit und der Güterverteilung
Die Einschläge kommen näher, die Krise boomt und zunehmend gerät der klassische politische Bürgerrechts-Liberalismus mit seinem Beharren auf individueller Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in die Defensive. Stattdessen erlebt in Zeiten grassierender Ungleichheit der Kommunitarismus, eigentlich ein bereits abgelegtes Projekt der 1990er Jahre, eine überraschende Renaissance. Sein aktueller Vordenker: Der US-Amerikaner Michael J. Sandel. Der Harvard-Professor versucht, den Diskurs über Gerechtigkeit jetzt neu zu begründen.
Es gibt Wichtigeres als Freiheit, davon ist Chandran Nair überzeugt, und Wichtigeres als Interessen der Individuen. Der in Malaysia geborene Nachkomme indischer Einwanderer und Globalisierungs-Theoretiker, Autor des Buches Consumptionomics (deutsch: Der große Verbrauch. Warum das Überleben unseres Planeten von den Wirtschaftsmächten Asiens abhängt) plädiert für den "starken, autoritären Staat" und "asiatische Werte".
Angesichts des absehbaren "Ende des Wachstums" müsse Asien vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts "eigene Ideen für seine sozialen Systeme entwickeln, ohne die ideologischen Schranken aus dem Westen zu übernehmen." Es gebe neue Prioritäten politischen Handelns:
Das Recht auf individuelle Freiheit wird hinter das Recht auf sanitäre Anlagen, Elektrizität, sauberes Wasser, sauberes Essen und Bildung zurücktreten. ... Die größte Bedrohung für die Entwicklung der Welt ist, dass westliche Demokratien die Interessen der Individuen zu sehr über die der Gemeinschaft stellen und dadurch grundlegende Probleme nicht gelöst werden können.
Nair stellt den an der Idee grenzenlos steigerbaren Konsums orientierten Kapitalismus und damit das Wirtschaftsmodell des "anglo-amerikanische Wirtschaftsliberalismus" infrage. Er verbindet dies allerdings mit einer radikalen Kritik an schwachen Institutionen, an aus seiner Sicht allzu-idealistischen Vorstellungen von Selbstverantwortung und demokratischer Mitbestimmung des Bürger-Konsumenten und einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem Primat des Prinzips der persönlichen Freiheit in den Demokratien des Westens. Gerechtigkeit lasse sich im Konfliktfall nur von oben herstellen.
Das Gefühl der Gemeinschaft
Gerechtigkeit gegen Freiheit, Gemeinschaft gegen Individualismus - diese Gegensatzpaare erinnern an eine schon vergessen geglaubte Debatte aus den späten 1980er und frühen 1990er-Jahren, den sogenannten "Kommunitarismus-Streit".
Vor über einem Vierteljahrhundert kam das Schlagwort Kommunitarismus auf, zunächst im Zusammenhang mit einer sehr speziellen Debatte US-amerikanischer Politikwissenschaftler. Die Rezeption von John Rawls' epochaler "Theorie der Gerechtigkeit", die bald nach ihrem Erscheinen, 1971, zu einem der Standardwerke der liberalen politischen Theorie wurde, führte zu einem Streit unter Insidern um das Wesen politischer Selbstbestimmung des Bürgers in der Demokratie und um die Neutralität des Rechts.
Der Streit verschärfte sich im Zuge der "post-analytischen" Wende der US-Philosophie und der Rückbesinnung auf den Pragmatismus und spitzte sich auf grundsätzliche Fragen zu: Genügt Legalität zur Integration der Bürger oder braucht es dazu auch "weiche" Schmier- und Bindungsmittel, ein Reservoir gemeinsam geteilter Grundüberzeugungen, Werte und gemeinsamer Erfahrungen, die den Patriotismus eines politischen Körpers begründen, ihm also vorausgehen, und nicht erst aus dem diskursiven Handeln einer Gruppe von Individuen folgen? Beruht, anders und moderner gefragt, der liberale Verfassungsstaat auf Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren oder gar schaffen kann? Oder ist dies nur ein Trugschluß phantasieloser Romantiker?
Liberals und Communitarians stritten hierüber, und der Streit ist seitdem zwar mehrfach umdefiniert worden, aber nie wirklich beendet. Seinen besonderen Charme schöpft er aus der Tatsache, dass die Frontlinien nur schwer klar in Rechts und Links zu gliedern sind. Auf Seiten der Kommunitarier treffen sich Sozialdemokraten mit Unionsanhängern, Aristoteliker mit Kommunisten, auf der Gegenseite findet man Thatcheristen und Neokonservative ebenso wie linksliberale Civil-Rights-Aktivisten und libertäre Marxisten. Dass die kommunitaristischen, antiindividualistischen Argumente dabei nun auch von Links kamen, war auf den ersten Blick überraschend, passte aber zum Zeitgeist der 1980er und 1990er Jahre.
Post-68er-WG-Erfahrungen und kalte Institutionen
Damals schien das aus den Post-68er-WG-Erfahrungen ins Politische transformierte Gefühl der Gemeinschaft, das quasi natürliche Legitimität herstellte, bindender als die ach so "kalten" Institutionen und ihre "bloße" Legalität.
Damals galt "small is beautiful" und das Lob kleinförmiger solidarischer Einheiten - dies verband Ideen der gerade sich etablierenden GRÜNEN mit der modernisierten CDU, die unter ihren Generalsekretären Kurz Biedenkopf und Heiner Geißler seit 1972 das Subsidiaritätsprinzip katholischer Sozial-Enzykliken in eine politische Programmatik gegossen hatte, die das bekannte konservative Jammern über die Erosion der Werte, der Traditionen und des Gemeinschaftlichen überhaupt in einen modernen Diskurs fließen ließ.
Die SPD sprang in den kurzen Vorsitzjahren unter Björn Engholm und Rudolf Scharping seit 1991 auf den fahrenden Zug auf und verschmolz den Kommunitarismus - durch eine modernisierte CDU/CSU und die sozialliberal gereiften GRÜNEN von beiden Seiten gleichermaßen unter Beschluss geraten - unter dem Tandem Lafontaine/Schröder seit 1995 mit Ideen der Modesoziologen Ulrich Beck und Anthony Giddens analog zu Tony Blairs Wahlsieg zum pathetisch vorgetragenen "Dritten Weg".
Dieser mündete dann bald in die bekannten und bis heute nicht ganz aufgearbeiteten sozialdemokratischen Dilemmata: Verlust ursozialdemokratischer Identität durch Preisgabe des Erbes der Arbeiterbewegung, der bürgerrechtlichen Tradition und der im Begriff des demokratischen Sozialismus aufgehobenen Systemalternative. So kam es ab 1998 zur Aufspaltung der SPD in einen klassischen und einen postmodernen Flügel und zur Abspaltung einer von Lafontaine geführten USPD unter dem Signum der LINKEN.
Gerechte Güterverteilung - die kommunitaristische Frage wird neu aktualisiert
All das klingt nur solange abstrakt und von gestern, wie man es nicht auf aktuelle Fragen zurückbezieht. Seit aber durch den Börsenkrach von 2008 und die Banken- und Finanzkrise der politische Konflikt um die Verteilung sozial knapper Güter an Dramatik erheblich zugenommen hat, ist die Bedeutung der auch moralischen und politischen Güterverteilung, und der Blick auf das Ganze, die den Kommunitarismus auszeichnen, wieder wichtig geworden.
Das allererste und elementarste dieser knappen Güter ist kein ökonomisches, sondern ein existentiell politisches: Es ist das Bürgerrecht selbst, die Voraussetzung zur Zugehörigkeit zu einer politischen Einheit. Nur wer uneingeschränkter Inhaber dieses "Rechts, Rechte zu haben" (Hannah Arendt) ist, wer nicht qua Alter, Geisteszustand, Bildungsgrad oder "Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte" als nur eingeschränkt wahlberechtigt und bürgerlich mündig gilt, und auch nicht als Staatenloser, Passloser, Asylant, Asylbewerber, Flüchtling oder Illegaler im Gemeinwesen bestenfalls geduldet oder nur ignoriert und damit potentiell jederzeit durch totalen Rechtsverlust gefährdet ist, kann "mit Recht" auf den vollen Schutz durch die Gesellschaft und auf weitere Leistungen (rechtsverbindlichen) Anspruch erheben, anstatt auf Gnadenerlass und Willkürentscheidung angewiesen zu sein.
Das zweite, damit einher gehende knappe Gut ist das Recht auf politische Partizipation. Das dritte dann ist das Recht auf gemeinsam geteilten Wohlstand, das Recht darauf, dass die soziale Schere nicht zu weit auseinanderklafft. Auch in Deutschland nimmt die soziale Ungleichheit zu. Sie tut dies sogar rasant, wie der Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler dies in seinem gerade erschienenen neuen Buch "Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland" in vielen Details beschreibt (vgl. Lasst uns richtig umverteilen!). Gleichheit und Gerechtigkeit in der Güterverteilung sind, so Wehler für das Funktionieren einer Gesellschaft elementar.
Neuformulierung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl
In groben Zügen zeichnete all dies die seit knapp 200 Jahren unter den Stichworten Moralität und Sittlichkeit geführten rechtsphilosophischen Debatten zwischen Kantianern und Hegelianern nach: Ergeben sich Grundsätze des (moralischen) Handelns allein aus Prinzipien der Vernunft, oder gehen diesen bereits Tradition, Sozialisierung und gemeinschaftliches Handlungswissen ("Bürgertugend" oder "Sittlichkeit") voraus? Pathetischer formuliert: Sind der Staat und seine Institutionen ein Instrument der Vertragspartner im Gesellschaftsvertrag, oder ein Wert an-sich? Ist die Gesamtheit der Bürger als Gesellschaft der Individuen mit wechselseitigen Eigeninteressen zu begreifen oder als eine Gemeinschaft, die als Ganzes politisch klüger ist, als die Summe ihrer Teile?
Ausgehend von der Einsicht in die schlichte Tatsache, dass sich aus dem Streben aller Bürger nach nichts anderem als ihrem privaten Vorteil noch lange nicht "das größte Glück der größten Zahl" ergibt, wird die kommunitaristische Frage nach dem Verhältnis zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl und die nach dem Ort des Gemeinsinns in modernen, individuell ausdifferenzierten Gesellschaften heute neu formuliert. Zum Schlüsselbegriff dieser Aktualisierung wird anstelle des alten, weltanschaulich ein für allemal kontaminierten Gegensatzes zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft neuerdings der Begriff der Gerechtigkeit.
Was also heißt überhaupt Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit - das Wort hört man oft und doch schillert es seltsam unklar. In über 2000 Jahren politischer Theorie hat es viele widerstreitende Definitionen gegeben. Plato definierte ihr Prinzip als "Jedem das Gleiche". Aristoteles setzte "Jedem das Seine" dagegen. Für Anwählte der Erniedrigten und Beleidigten ist Gerechtigkeit seit jeher ein Ausgleichsprinzip auf dem Weg zu mehr Gleichheit, doch umgekehrt kann der Begriff zum Beispiel als "Chancengerechtigkeit" (und damit Gegenbegriff zur Chancengleichheit) oder als als "Steuergerechtigkeit" als ein Kampfbegriff für den Erhalt oder die Schaffung von mehr Ungleichheit dienen.
Was also heißt überhaupt Gerechtigkeit? Während Freiheit und Gleichheit Antipoden zu sein scheinen, die sich wechselseitig bedingen, einschränken, aber auch ergänzen, steht das Prinzip der Gerechtigkeit merkwürdig dazwischen. Ihre Bedeutung scheint im Auge des Betrachters zu liegen. Gerechtigkeit ist dabei im doppelten Sinn ein normatives Kriterium: für die Antwort auf die Frage "Was soll ich berechtigterweise tun?" wie auch "Was darf mir berechtigterweise angetan werden?" und schließlich ebenso "Was darf eine Gesellschaft von ihren Mitgliedern verlangen, und was muss sie ihnen umgekehrt garantieren und gewährleisten?". Gerechtigkeit hat also gleichzeitig eine ethische wie eine politische Dimension. Sie steht damit auch in Beziehung zur Sphäre des Rechts.
Gerechtigkeitsgefühl und Alltagsintutionen
Diese Entfaltung des Gedankens der Gerechtigkeit seht im Zentrum der zwei neuen, jetzt auch auf Deutsch erschienen Bücher von Michael J. Sandel. Sandel, der in Harvard Philosophie lehrt und im Kommunitarismusstreit der "junge Mann" neben den etablierteren und profilierteren US-amerikanischen Theoretikern des Kommunitarismus - Michael Walzer, Alasdayr MacIntyre, Amitai Etzioni, Robert Bellah und Charles Taylor - gewesen ist, spitzt darin an diversen Fallbeispielen die Selbstwidersprüche individueller Freiheit und den Konflikt verschiedener jeweils individueller Interessen konsequent zu und konfrontiert diese Zuspitzungen mit dem Gerechtigkeitsgefühl seiner Leser. Ihrem Empfinden für "das Richtige" wie er es nennt oder ihren "Alltagsintuitionen".
Die Frage, ob das eigentlich immer das Gleiche ist, und ob Intution überhaupt ein angemessenes Kriterium für die Beurteilung von Gerechtigkeitsfragen sind, wäre schon der erste Einwand, der sich hier stellt.
Verborgene Machtverhältnisse
Gerechtigkeit gegen individuelle Freiheit, die Spannung zwischen der Autonomie des rationalen Einzelnen und den Interessen der Bürgergemeinschaft, die Klage über die soziale Erosion der modernen Gesellschaft, die Aporien und Selbstwidersprüche einer nur als Autonomie, als Freiheit von verstandenen Freiheit - man könnte hier natürlich innehalten und bemerken, dass Marx Ähnliches bereits 1844 geschrieben hat, und auch die Autoren der Frankfurter Schule im 20. Jahrhundert. Im Vergleich zu jenen verzichtet Sandel nämlich in diesen Passagen darauf, die Mittelklasse der Gegenwartsgesellschaften tatsächlich in ihrer "Alltagsintuition" herauszufordern. Die kommunitaristischen Klagen über das "Wertedefizit moderner Gesellschaften" entsprechen dieser vielmehr komplett.
Vor allem aber sind die Probleme und Defizite, die Sandel beschreibt, keine moralischen, sondern politische. Gerechtigkeit hat bereits auf der Ebene ihrer Definition mit Machtverhältnissen zu tun. Und was man unter Gemeinschaft versteht, auch. Der Kommunitarismus geht - das ist für Sandel symptomatisch - in seinem impliziten Slogan der "Gemeinschaft über alles" der Machtanalyse strikt aus dem Weg.
Dass der Kampf um gemeinsame Werte, Grundlagen der Gesellschaft und um Gerechtigkeit mit allen erdenklichen Waffen und Mitteln ausgetragen wird, und dass Gemeinsinn und Gerechtigkeit eine Frage der realen Machtverhältnisse sind, der alltäglichen und gesellschaftlichen Kämpfe um Leben und Überleben, bleibt ihm verborgen.
Für aktive Ordnungspolitik
Spannender wird es dort, wo Sandel für eine Stärkung der Institutionen und aktive Ordnungspolitik plädiert: So kritisiert er etwa die Einführung handelbarer Zertifikate im internationalen Klimarecht. Damit würden die Unternehmen nur ein gutes Gewissen erwerben. Stattdessen müsse man Umweltsünden um des moralisch angemessenen Nebeneffekts willen stigmatisieren.
"Man sollte die Menschen nicht unterschätzen", argumentieren die Liberalen dagegen und verweisen darauf, dass Verbote unmündig machten. Genau andersherum sieht es Sandel: Mit Verboten, besser noch Geboten reagiert der Staat auf das unmündige - weil egozentrische - Verhalten der Konzerne und mancher Bürger.
Politische Institutionen müssen sich nach seiner Auffassung stärker um die Produktion und Reproduktion von Bindungen kümmern. Die Bürger müssen auch Werte und Verpflichtungen lernen, sie müssen lernen ihre Freiheit zu gebrauchen. Aus der neoliberalen einseitigen Freiheit von muss eine Freiheit zu werden.
Die Spannung zwischen der Kontextversessenheit des Kommunitarismus und die Kontextvergessenheit des Liberalismus könnte man also auflösen und vermitteln durch eine Position, die man am ehesten als Republikanismus beschreiben lässt - im klassischen Verständnis dieses Begriffs, das wenig mit der gleichnamigen amerikanischen "republican" Party und gar nichts mit deren rechtsextremem deutschen Namensvetter zu tun hat, aber viel mit den Traditionen der Römischen Republik, den Stadtstaaten der frühen Neuzeit und den modernen Republiken in der Tradition der französischen seit 1789.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.