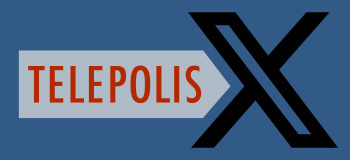Forencheck: Forschung zu klimaresilienten Bäumen, Förderung von kleineren Erdgasvorkommen, blockiertes Getreide in der Ukraine

Drei Fragen aus dem Forum. Eine Telepolis-Kolumne.
Küsten-Mammutbäume als klimaresistente Alternative für den Wald?
Auf den Artikel "Deutsche Wälder unter Stress" von Susanne Aigner, der über Schäden bei allen Hauptbaumarten berichtet, fragt ein User:
Im Südwesten Deutschlands wurden im 19. Jahrhundert etliche Küsten-Mammutbäume gepflanzt, die mittlerweile stattliche Ausmaße haben.
Wie vertragen die sich mit dem Klimawandel? Wäre das eine Lösung für die Zukunft?
Küsten-Mammutbäume und andere Sequoia-Arten wachsen auch in manchen Landschaftsparks und größeren Gärten und konnten auch hier stattliche Größen und Alter erreichen. Ob die Mammutbäume im größeren Stil auch für einen klimaangepassten Waldumbau geeignet sein könnten, darüber werden die Meinungen von Forstexpert:innen aber auseinandergehen.
Die Umweltorganisation Greenpeace etwa setzt auf natürliche Waldverjüngung, d.h. auf zerstörten Waldflächen würden keine neuen Bäume gepflanzt, sondern abgewartet, dass sich resistentere Arten wieder von selbst ansiedeln. Dazu würden die in Nordamerika heimischen Mammutbäume mit Sicherheit nicht zählen.
Manche Forstbehörden und -institutionen ziehen aber auch die Anpflanzung neuer, ursprünglich nicht in Deutschland heimischer Baumarten in Erwägung. So gibt es im Arnsberger Wald in Nordrhein-Westfalen Versuchsflächen mit verschiedenen Baumarten. Zum Projektziel heißt es:
Mit Hilfe der im Rahmen des von der FNR geförderten Verbundprojektes "Erhalt bzw. Steigerung der nachhaltigen Holzproduktion" angelegten Kulturen können Baumarten aus anderen biogeografischen Regionen identifiziert werden, die an erwartete Standortveränderungen angepasst sind und in heimische Waldökosysteme integriert werden können.
Zu den im Frühjahr 2018 gepflanzten Bäumen zählt auch der Küsten-Mammutbaum, entwickelt sich bisher gut und konnte auch Frostschäden überstehen. Doch eine abschließende Bewertung wird sich wahrscheinlich erst in Jahren bis Jahrzehnten vornehmen lassen.
Auch die Bayerische Forstverwaltung nennt in der Broschüre "Baumarten im Klimawald" den Küsten-Mammutbaum, empfiehlt seine Anpflanzung im Wald aber nur unter wissenschaftlicher Begleitung. Zu den in dieser Kategorie gelisteten Baumarten heißt es:
Bei diesen Baumarten sind weder die Anbauwürdigkeit, die Anbaufähigkeit, noch ihre Eignung im künftigen Klima abschließend geklärt. Risiken können bislang noch nicht hinreichend abgeschätzt werden. Hinreichende Anbauerfahrungen liegen, abgesehen von vereinzelten Erkenntnissen im Rahmen punktueller oder regionaler Anbauten, noch nicht vor.
Generell seien heimische Baumarten, auch seltene heimische Baumarten zu bevorzugen, weil sie sich besser ins Ökosystem integrieren. Dass Mammutbäume in großem Stil in deutschen Wäldern wachsen werden, ist nach dem derzeitigen Stand der Forschung also eher nicht zu erwarten.
Ist die Förderung kleinerer Erdgasvorkommen wirtschaftlich?
Den Artikel "Erdgas unter der Nordsee: Fällt das Wattenmeer dem Ukraine-Krieg zum Opfer" von Wolfgang Pomrehn kommentiert ein User:
60 Mrd m3 Gasfeld bei einem Jahresbedarf in D von 90 Mrd m3, da lohnt es sich nicht mal die Geräte hinzufahren, geschweige denn aufzubauen. Dann auch noch im Naturschutzgebiet. Welcher Bürokrat denkt sich so was aus. Dafür würde nicht mal D.Trump sein Golfspiel unterbrechen. Das ist bestenfalls Spielwiese für die Forschung.
Nein, wenn Europa Gas fördern will, dann geht das - im Mittelmeer vor Zypern. (…)
Auch wenn es auf der Welt Gasfelder in ganz anderer Größenordnung gibt, lässt sich wohl kaum sagen, dass ein Vorkommen von 60 Milliarden Kubikmeter ökonomisch uninteressant wäre. Zumal bereits ein niederländisches Unternehmen konkrete Pläne zu Ausbeutung des Erdgasfelds im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in der Nordsee hat, das Unternehmen One Dyas.
Dieses Unternehmen hat bereits seismische Untersuchungen und "Aufsuchungsbohrungen" vorgenommen: "Die im GEMS-Projekt durchgeführten Aufsuchungsbohrungen zeigen, dass im N5-A-Feld Erdgas vorhanden ist und dass dieses Gas gefördert werden kann", ist auf der Projektwebsite von One Dyas zu lesen.
Zur Förderung will das Unternehmen eine Plattform errichten, von der aus dann verschiedene Förderbohrungen vorgenommen werden. Die Plattform müsste über eine 13 Kilometer lange Pipeline erschlossen werden. Die geplante Plattform stünde nicht im Nationalpark Wattenmeer selbst, aber sehr dicht daran angrenzend, wie Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann kritisiert.
Die Pläne für das Projekt hat One Dyas bereits seit 2017 entwickelt, bislang hatte aber die niedersächsische Landesregierung die Genehmigung verweigert. Da das Gasfeld zu beiden Ländern gehört, würden hier übrigens auch nicht die gesamten 60 Milliarden Kubikmeter Deutschland zugutekommen.
Am Jahresbedarf von 90 Milliarden Kubikmetern orientiert, ist übrigens auch die seit Jahrzehnten in Deutschland geförderte Erdgasmenge sehr gering, im Jahr 2021 lag sie bei rund 5,2 Milliarden Kubikmetern. Die wahrscheinlich förderbaren Reserven wurden 2021 auf 32,4 Milliarden Kubikmeter geschätzt.
Was das Erdgasfeld vor Zypern angeht, das aber von der Türkei beansprucht wird, so stellt sich die Frage, ob ein neues Erdgasprojekt in einer Konfliktregion wirklich zu einer größeren Versorgungssicherheit beitragen würde. Im Hinblick auf die Klimaziele bleiben ohnehin alle neuen Erschließungen fossiler Brennstofflagerstätten fragwürdig.
Welche Arten von Getreide warten in der Ukraine auf den Export und lassen sich damit wirklich Hungerkrisen abwenden?
Unter anderem als Reaktion auf den Artikel "Freie Fahrt für Getreide aus der Ukraine" von Susanne Aigner befassen sich zahlreiche Kommentare mit den Inhalten der ukrainischen Getreidesilos und der Bedeutung dieser Mengen für die Ernährungslage, vor allem in afrikanischen Ländern. Ein User schreibt:
(…) Ich habe keinen einzigen Mainstream-Bericht gefunden, in dem die ominösen, durch den Krieg angeblich nicht exportierbaren 25 Mio. Tonnen Getreide in ukrain. Silos nach Getreidearten aufgeschlüsselt werden. Auf den überragenden Anteil des Futtergetreides hinzuweisen würde ja auch die gewünschte Assoziation "Russischer Krieg sorgt für Hunger in Afrika" bei den Mediennutzern erschweren.
Eine Aufschlüsselung nach Getreidearten und sogar danach, ob es sich nun um Lebensmittel oder um Futtermittel handelt, wird sich schwerlich finden lassen. Die Ukraine erzeugte im Jahr 2020 33 Millionen Tonnen Weizen, davon gingen 70 Prozent in den Export.
Mit 42 Millionen Tonnen war die Maisernte sogar noch größer, auch hier werden große Mengen exportiert, wie erst kürzlich über die Schiene nach Westeuropa. Mais wird zum größten Teil als Tierfutter angebaut, beim Weizen unterscheidet man zwischen Brotweizen und Futterweizen, was aber in den Exportstatistiken nicht gesondert aufgeführt wird.
Dabei ist es nicht so, dass Futterweizen für Menschen nicht genießbar wäre. Die Kategorisierung des Weizens erfolgt nach dem Proteingehalt. Dass es sich bei einem Teil des in ukrainischen Silos lagernden Getreides um Futtergetreide handelt, bildet dabei nur die Situation der globalen Landwirtschaft ab. Rund 42 Prozent des weltweit erzeugten Getreides dient direkt der menschlichen Ernährung, knapp 38 Prozent wird an Tiere verfüttert, gut 20 Prozent fällt unter "Sonstige".
Ein Ausweg aus der Ernährungskrise könnte also sein, die Fleischproduktion herunterzufahren und mehr Menschen zu ernähren. Die aktuelle Ernährungskrise in zahlreichen afrikanischen Ländern ist jedoch nicht allein auf den akuten Mangel an Getreide zurückzuführen, sondern auf strukturelle Schwächen im globalen Ernährungssystem, stellt das internationale Expertengremium für nachhaltige Ernährung IPES Food (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) klar.
Zu diesen Schwächen zählen hohe Importabhängigkeiten und Intransparenz und Spekulation auf den Märkten, die die Preise in die Höhe treiben. "Die weltweiten Weizenvorräte sind im Vergleich zu den historischen Trends derzeit hoch, und das Verhältnis zwischen Vorräten und Verbrauch ist angemessen; was die Preisspitzen verschlimmert, ist die mangelnde Transparenz der Bestände und die anscheinend exzessive Rohstoffspekulation", heißt es in der Pressemitteilung von IPES Food vom 6. Mai 2022.
Konflikte, Klimawandel, Armut und Ernährungsunsicherheit würden einen Teufelskreis bilden. Als Gegenmaßnahmen werden u.a. Schuldenerlasse für arme Länder, transparentere Märkte, eine diversifizierte Agrarproduktion und eine Reduktion von Biodieselherstellung und Viehhaltung vorgeschlagen.