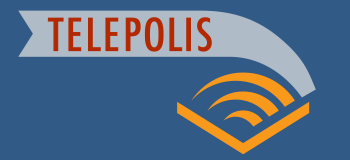Fernwärme vor großem Umbau: Millionen Haushalte von Energiearmut bedroht?

Baustelle für Fernwärme
(Bild: FooTToo / Shutterstock.com)
Der klimaneutrale Umbau der Fernwärme könnte für viele Verbraucher zum Albtraum werden. Ohne Regulierung drohen explodierende Preise und soziale Verwerfungen.
Die Fernwärme in Deutschland steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Bisher stammt ein Großteil der Wärme noch aus klimaschädlichen fossilen Quellen wie Erdgas oder Kohle. Doch das soll sich ändern: Bis 2045 will die Bundesregierung die Fernwärmeversorgung nahezu vollständig klimaneutral machen und massiv ausbauen.
Doch der grüne Umbau der Fernwärme hat seinen Preis – und der könnte für Millionen Haushalte zur schweren Belastung werden. Schon heute müssen immer mehr Menschen einen wachsenden Teil ihres Einkommens für Heizung und Warmwasser aufwenden. Zehn Prozent der Haushalte, also knapp drei Millionen, gelten als besonders gefährdet. Doch das könnte erst der Anfang sein.
Explodierende Fernwärmepreise befürchtet
Experten schlagen Alarm: Ohne wirksame politische Gegenmaßnahmen droht die Fernwärme für viele Bürger unbezahlbar zu werden. Eine Studie der Deutschen Energie-Agentur (dena) warnt, dass die enormen Investitionskosten von bis zu 117 Milliarden Euro bis 2045 die Preise in die Höhe treiben könnten.
"Würden sämtliche Investitionskosten vollständig an die jeweiligen Netzkundinnen und -kunden weitergegeben, würde das die Bezahlbarkeit der Wärmeversorgung für einen wesentlichen Teil der Haushalts- und Gewerbekunden stark gefährden", so die alarmierenden Worte der Studienautoren.
Im Klartext: Sollten die Preise stark steigen, könnten aber weitere Millionen Haushalte finanziell überfordert werden. Gerade einkommensschwache Familien, Alleinerziehende und Rentner wären dann von Energiearmut bedroht – also der Unfähigkeit, ihre Wohnung angemessen zu heizen.
Die Folgen wären dramatisch: unbeheizte Wohnungen, Verzicht auf Warmwasser, im schlimmsten Fall Stromabschaltungen und Wohnungsverlust. Damit droht eine neue soziale Spaltung: in jene, die sich Wärme leisten können, und jene, die frieren müssen.
Kommunen vor gewaltigen Herausforderungen
Auch für die Städte und Gemeinden ist der Umbau der Fernwärme eine Mammutaufgabe. Sie sollen bis 2026 flächendeckend Wärmepläne vorlegen und den Ausbau von klimaneutralen Wärmenetzen massiv vorantreiben. Doch vielerorts fehlt es an Geld, Personal und Expertise.
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) schlug schon vor zwei Jahren Alarm: Ohne deutlich mehr Fördermittel seien die nötigen Milliardeninvestitionen nicht zu stemmen. Zudem seien die Fristen viel zu kurz. Es drohe ein Flickenteppich aus unvollständigen Wärmeplänen und Verzögerungen beim Netzausbau.
Politik muss jetzt handeln
Damit mit der Energiewende die soziale Schieflage in Deutschland nicht noch größer wird, muss die Bundesregierung stärker regulierend eingreifen. Um "sozialverträgliche Fernwärmepreise zu ermöglichen", müsse der Staat laut dena neue Finanzierungsmöglichkeiten prüfen. Dazu gehören laut Studie:
- eine stärkere öffentliche Förderung, etwa über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)
- alternative Finanzierungsmodelle wie zinsgünstige Kommunalkredite
- die Einbindung privaten Kapitals
Entscheidend für die Akzeptanz der Fernwärme sei zudem eine transparente und faire Preisgestaltung, betont die dena-Studie. Bisher stehen Fernwärmeversorger in der Kritik, intransparente Preisgleitklauseln zu nutzen. Verbraucher können kaum nachvollziehen, wie sich die Preise zusammensetzen.
Die dena empfiehlt daher eine Reform der Preisregulierung. Dazu gehört etwa eine Anpassung der Preisbildung an die realen Kosten für Investitionen, Betrieb und Instandhaltung. Auch eine verpflichtende Veröffentlichung von Preisbestandteilen und verständliche Musterrechnungen werden angeregt.
Für mehr Verbraucherschutz könnte laut dena auch eine unabhängige Preisaufsichtsbehörde sorgen, die bei Missbrauch sanktionieren kann.