"Ich bin kein Nazi, aber ...!"
14.11.2019 - Richard Winterstein
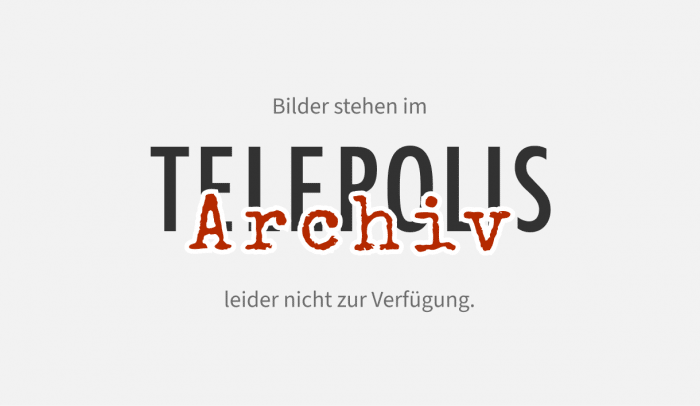
Eine Redensart macht Karriere und verrät dabei Aufschlussreiches über deren Anwender
"Ich bin kein Nazi, aber ...": diese Einleitung zu einer dann nachfolgenden Aussage, die inzwischen zum selbstverständlich vorgetragenen Haltungsrepertoire einer nicht geringen Zahl von "kritischen" Bürgern zu gehören scheint, hat inzwischen eine berüchtigte Aktualität erlangt, dokumentiert sie doch die gegenwärtige Wirksamkeit neofaschistischer Propaganda bei einem nicht unbeträchtlichen konservativ gestimmten Teil der deutschen Bevölkerung, dem die geistige und politische Nähe zu den Neofaschisten kein wirkliches Problem zu bereiten scheint.
"Ich bin kein Nazi, ...": Wer diese Behauptung aufstellt, weiß, was ein Nazi ist, sonst diente diese deutsche Spielart eines Faschisten ja nicht als Bezugsinstanz, wenngleich mit einem widersprüchlichen Ansinnen versehen. Er oder sie weiß auch, dass Nazis ein gesellschaftliches Problem darstellen, das - in welcher Form auch immer - öffentlich thematisiert wird und dadurch überhaupt erst als individuelle Bezugsinstanz interessant wird.
Dass dieses Problem nicht nur in der Möglichkeitsform, sondern ganz real existiert, ist ebenfalls kaum abzuleugnen. Bei den neuzeitlichen Nazis handelt es sich schließlich um die Wiederkehrer und Befürworter eines mit verheerenden Begleiterscheinungen und Folgen ausgeführten gesellschaftlichen Totalitarismus aus der jüngeren deutschen Geschichte, was auch den an Politik und Geschichte eher uninteressierten Bürgern bekannt sein dürfte. Desinteresse an dem, worauf sie sich da beziehen, ist den Anwendern dieser Redewendung ohnehin nicht zu unterstellen. Denn es handelt es sich hier um die bewusste Bezugnahme auf eine unter öffentlicher Beobachtung stehende faschistische Bewegung, die ihrerseits alles Mögliche unternimmt, um sich Beachtung zu verschaffen.
Wer sich als "... kein Nazi ..." versteht, hat also nicht nur eine blasse Vorstellung davon, dass das deutsche Nazitum mit Faschismus, Menschenverachtung, politischer Verfolgung, Massenvertreibung und -vernichtung und Krieg zu tun hatte und nach Vorstellung der neuen Nazis auch weiterhin damit zu tun haben soll. Er oder sie weiß wohl ziemlich gut Bescheid darüber, auf was da persönlich Bezug genommen wird.
"Ich bin kein Nazi, aber ...": darin ist die unterschwellige Drohung enthalten, dass auch das Gegenteil der Fall sein könnte. Denn wer seine Selbstauskunft mit einem Aber zum Vorbehalt und zur Einschränkungs versieht, welches die vorangegangene Distanzierung abschwächt, aber keinesfalls aufhebt, kann sich anscheinend doch vorstellen, ein Nazi zu sein. Das "..., aber ..." als einschränkender Konjunktiv nämlich bildet den Übergang zu einem Akt der Verständnisbekundung, wenn nicht sogar zu einer Identifikationsaussage, d.h. einem sich Wiedererkennen in den Anliegen eines Nazis und ist keineswegs Ausdruck einer entschiedenen Distanzierung.
"Ich bin kein Nazi, aber ...": das sagt sich so leicht dahin. Kaum einer würde sagen: "Ich bin kein Faschist, ..." oder: "Ich bin kein faschistischer Totschläger, ...", oder noch pointierter: "Ich bin kein faschistischer Massenmörder, aber ...". Für alle aufgeführten Zuschreibungen lassen sich konkrete Personen aus dem gegenwärtigen rechtsradikalen Spektrum benennen, dafür bedarf es also gar nicht des Rückgriffs auf das Tausendjährige Reich.
Der "Nazi" erscheint hier als die harmloseste Variante in der Aufzählungsrangfolge, mit ihm kann sich ein Normalbürger anscheinend ganz gut identifizieren. Ihm wird zwar rechtsradikales Gedankengut zugeschrieben, aber an einen Rechtsterroristen (Jena) oder Massenmörder (Breivik) wird dabei eher nicht gedacht. Der "Nazi" erscheint hier lediglich als der rechtslastige Nachbar von nebenan, der er in zahlreichen Orten der Republik ja auch tatsächlich ist, und dem zwar ein provozierendes Auftreten, aber kein Mordanschlag zugetraut wird.
Wenn aber 1000 Faschisten, wie am 3. Oktober geschehen, durch Berlin ziehen und im Beisein der sie begleitenden Polizei unbehelligt skandieren können: "Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot!", dann ist das ein Beweis dafür, dass der Massenmord ein sozusagen programmatischer Bestandteil auch des modernen Naziwesens ist und nicht nur die Idee von angeblich geistig und ideologisch verirrten Einzeltätern. Eine wertlose Distanzierung nach Art des "Ich bin kein Nazi, aber ..." hat sich mit dem ideellen Nazi, der man angeblich nicht sein mag, bereits in eine Übereinstimmung gebracht, die von konkreten Faschisten und ihren gewaltsamen Umsturzvorhaben nicht mehr grundsätzlich abzugrenzen ist. Das sehen die Anwender dieser Redewendung natürlich anders.
Abgrenzungsproblem
Sich von Nazis abzugrenzen, stellt keine besondere bürgerschaftliche Glanzleistung dar, denn welcher mit einer ausreichenden Portion Verstand und Mitmenschlichkeit ausgestattete Mensch, der Gründe dafür hat, sich über seine vermeintliche oder tatsächliche gesellschaftliche Benachteiligung beklagen zu müssen, würde die Erfüllung seines Anliegens ernsthaft im Errichten einer faschistischen Diktatur, in Menschenverachtung, Massenvertreibung und Massenmord usw. erwarten wollen?
Daraus kann geschlossen werden, dass die kleinbürgerlichen Nazi-Sympathisanten zwar einerseits durchaus wissen, in wessen politische Nähe sie sich mit ihrer ideologischen Sympathiebekundung begeben, sie aber eher nicht davon ausgehen dürften, dass im politischen Erfolgsfall eine neue Naziherrschaft wiederum zu einem Faschismus der bekannten deutschen Art führen würde. Eher ist anzunehmen, dass sich die gegenwärtigen Nazi-Sympathisanten eine Politik nach dem Muster der reaktionär beherrschten osteuropäischen Staaten einschließlich Russlands wünschen und vorstellen könnten: eine Politik nämlich der propagandistisch geprägten Bevorzugung der jeweiligen nationalen Bevölkerungsmehrheit, die den in jedem Staat ohnehin vorherrschenden Nationalismus der Bürger bedient und ihnen damit das Gefühl vermittelt, von einer Herrschaft regiert zu werden, die ihre eigenen persönlichen Staatsbürgeranliegen ernst nimmt.
Dass auch eine autoritäre Demokratie nach illiberalem Muster in die faschistische Barbarei führen kann und diese möglicherweise die dafür an heutige Verhältnisse angepasste moderne Übergangsform darstellt, dürfte zumindest von deren Mitläufern eher nicht erwartet werden, doch schützt mangelndes Vorstellungsvermögen vor falschen Annahmen nicht.
Die Neofaschisten sind deshalb erfolgreich, weil sie mit ihrer Propaganda an dem in demokratischen Gesellschaften wie selbstverständlich vorhandenen und gepflegten staatsbürgerlichen Bewusstsein andocken und damit bei den Bürgern mehr oder weniger offene Türen einrennen. Wer sich mit den Anliegen des eigenen Staates identifiziert, wer den Slogan "Der Staat sind wir" als wahr annimmt, wer die gesellschaftliche Rang- und Hackordnung im Prinzip akzeptiert, sich in einem Leben im Rahmen eines gewohnten gesellschaftlichen Unterordnungsverhältnisses eingerichtet hat und dessen Fortsetzung um jeden Preis als sinnvoll erachtet, findet in den Versprechungen der Neofaschisten die Antwort auf seine untertänigen Wunschvorstellungen. Wenn damit nebenbei auch chauvinistische und rassistische Stereotypen mit bedient werden, macht dies die rechtsradikale Wahlalternative nur umso attraktiver.
Glaubwürdigkeitsproblem
Die Aussage "Ich bin kein Nazi, aber ..." bebildert die Schizophrenie des bürgerlich-konservativen Selbstbildes: Von moralischen Vorbehalten nur schwach berührt, kann die Identifikation mit dem ins Barbarische ausgreifenden Radikalnationalismus nur umso deutlicher ausfallen. Die Glaubwürdigkeit der darin angedeuteten Distanzierung hebt sich bereits im unmittelbar anschließenden "..., aber ..." sofort wieder auf, denn sie bescheinigt dem dann Folgenden ein Maß an Akzeptanz, welches nur unter weitgehender Absehung von allem, was das Nazitum wesentlich ausmacht, angeeignet werden kann.
Die weniger als halbherzige Distanzierung verrät vielmehr, dass die Vorstellung, trotz anderweitiger Verlautbarung doch ein Nazi zu sein, gleich hinter dem Komma lauert, denn in der Sache besteht ja Übereinstimmung, und die will auf jeden Fall zum Ausdruck gebracht werden. Würde die nach dem Komma auftauchende Sache von einem bekennenden Demokraten vorgetragen, bräuchte es die im ersten Halbsatz erfolgte Distanzierung überhaupt nicht, und alles wäre in bester demokratischer Ordnung. Es ist die Übereinstimmung in der Sache, die die vorab erfolgte Distanzierung unglaubwürdig erscheinen lässt und den eigentlichen Kern des Anliegens freilegt.
Die Distanzierung ist ein ungeliebter Reflex auf die halbherzig und nur unter wiederholt auftretenden Geburtswehen sich vollziehende öffentlich-demokratische Ächtung des Nazitums. Sie definiert (noch) eine prinzipiell durchlässige Grenze, bei deren Überschreiten der Ausschluss aus dem Konsens der Demokraten wirksam wird. Diesem drohenden Ausschlussszenario will sich der Nazi-Sympathisant lieber entziehen, dafür ist ihm die demokratische Fraktion noch zu groß und die faschistische zu klein.
Mit dem "..., aber ..." jedoch wird die Möglichkeit des Übertritts ins demokratiefeindliche Lager vorsorglich offen gehalten und schon einmal in Gedanken und als implizite Drohung an die demokratische Mehrheitsgesellschaft durchgespielt: wenn ihr meine Anliegen - so falsch und herbei phantasiert die auch sein mögen -, nicht zur Kenntnis oder besser noch ernst nehmt, kann ich meiner Sympathie ohne weiteres den tatsächlichen Übertritt ins von euch verfemte Lager folgen lassen.
Einig in der Sache
Wer sachliche Übereinstimmungen mit den Neofaschisten ausmacht und für sich in Anspruch nimmt, hat bereits die verbindende Ebene gefunden, auf die es ihm oder ihr ankommt:Aalles andere ist dann nur noch moralisches Beiwerk, auf das im Ernstfall - nämlich wenn es dann tatsächlich um die knallharte Durchsetzung der Sache geht - gern verzichtet werden kann.
Diese Befürchtung dürfte auch die Versteher jener berühmten "Besorgnis" umtreiben, die gern als Berufungstitel für eine verständnisheischende Befassung mit den Anliegen der Nazi-Sympathisanten ins Feld geführt wird. Diese "Besorgnis" wird bei mit existenziellen Sorgen belasteten Bürgern, derer es im reichen Hierzulande ja nicht wenige gibt, allerdings immer nur dann verortet, wenn sie nach rechts außen abzudriften drohen und sie dadurch den eben nicht ganz unberechtigten Verdacht nähren, dass es von einer demokratischen zu einer neofaschistischen Einstellung anscheinend nur ein kleiner Schritt ist.
Wie anders ist zu erklären, dass Wahlbürger anscheinend problemlos von demokratisch sich verstehenden Parteien aller Coleur zu den Neofaschisten wechseln können? Dieser Wechsel in der Wählergunst ist nur möglich, wenn es ein Gemeinsames zwischen den verfeindeten Parteien gibt, so sehr dies von jenen auch bestritten werden mag. Wie dieses Gemeinsame beschaffen sein könnte, wollen die betroffenen Parteien aber anscheinend lieber nicht so genau wissen, denn dies würde ja notwendigerweise die ganz gewöhnlichen und keineswegs als verdächtig erscheinenden staatsbürgerlichen Einstellungen, die den Erwartungen und dem Wahlverhalten der Bürger zugrunde liegen, zum Thema einer kritischen Betrachtung machen müssen. Und in der Folge kämen dann auch die ideologischen Grundlagen der Parteien ins Blickfeld des öffentlichen Interesses und die Frage auf, wieso Wähler sich überhaupt von einer politischen Richtung vertreten wähnen können, die doch angeblich dem bis vor einiger Zeit bei den Wählern durchaus beliebten eigenen politischen Wollen so vollkommen entgegengesetzt sein soll.
Wirkungslose gesellschaftliche Ächtung
Wenn "besorgte" Bürger ihre Anliegen von einer Wahl zur anderen besser von einer Partei vertreten wähnen, die von allen anderen als eigentlich unwählbar stigmatisiert wird und dieses Stigma damit notwendig auch auf deren Wähler übergeht, so lässt sich daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass die damit verbundene gesellschaftliche Ächtung für diese Bürger anscheinend kein oder allenfalls nur ein nachgeordnetes Problem darstellt.
Wenn eine ganze Wählerschaft es in Kauf nimmt, aus der demokratischen Konsensgemeinschaft aufgrund ihres Wahlverhaltens ausgeschlossen zu werden, dann ist dies ein Hinweis darauf, wie wenig ihnen die Zugehörigkeit zu eben jener Gemeinschaft eigentlich noch bedeutet. Sie haben dann bereits ihre Mitgliedschaft in dieser Konsensgemeinschaft aufgekündigt und in der Partei der Neofaschisten ihre neue politische Heimat gefunden.
Wie sehr es ihnen dabei auf eine Abkehr von den Prinzipien der demokratischen Parteien ankommt, belegt der Umstand, dass sie sich in der Sache, d.h. mit dem "..., aber ..." ihres politischen Selbstverständnisses, bereits mit ihrer neuen Parteiheimat angefreundet haben. Mit ihrer Übereinstimmung in der Sache haben sie für sich einen hinreichenden Grund für ihre Wahlentscheidung gefunden, die auch durch die rassistischen und terroristischen Aktivitäten des ideologienahen Hardcore-Naziumfeldes anscheinend nicht in Zweifel gezogen werden, wie die neuesten Wahlergebnisse vermuten lassen. Ob sich daraus bereits eine generelle Akzeptanz faschistischer Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung ableiten lässt, sei dahingestellt.
Zumindest von einer moralischen Warte aus betrachtet dürfte das neofaschistisch ausgerichtete Wahlverhalten ein Hinweis auf eine geringer werdende Distanz zu Aktivitäten dieser Art sein. Durch den Trick der Aufspaltung des eigenen politischen Selbstverständnisses in eine distanzierende und eine akzeptierende Seite halten sich die neofaschistisch orientierten Wähler einen Rückweg frei, auf den sie bislang anscheinend nicht verzichten möchten. Möglicherweise liegt dies auch darin begründet, dass die Neofaschisten bisher noch keine Möglichkeit hatten, ihr Programm praktisch umzusetzen, sie also auch ihre Problemlösungskompetenz im Sinne ihrer Klientel noch nicht unter Beweis stellen konnten bzw. mussten. Denn ob die Neofaschisten die hochgesteckten Erwartungen ihrer Wähler an eine politische Rechtswende praktisch auch tatsächlich würden erfüllen können, ist noch nicht bewiesen.
Fazit
Soviel lässt sich mit Bezugnahme auf die Wahlergebnisse des vergangenen Jahres bereits festhalten: Weder die moralisierende Ausgrenzungsstrategie der demokratischen Parteien und Öffentlichkeit den rechtsextrem orientierten Wählern gegenüber noch die Verständnis für deren Anliegen einfordernden Bemühungen mancher Politiker und Medienleute haben das gewünschte Ergebnis erbracht, nämlich eine Abkehr dieser Wähler von ihrer Hinwendung zu den Neofaschisten. Wenn sich sowohl Vorwürfe moralischer Art als auch eine um Verständnis bemühte Haltung als nicht zielführend erwiesen haben, liegt das womöglich an den Argumenten, die dabei zur Anwendung kamen, wenn sich die adressierten Bürger durch sie von ihren rechtslastigen Ansichten und Haltungen nicht haben abbringen lassen wollen.
Wer die subalterne Rolle, die den überwiegend lohnabhängigen Bürgern in diesem Land zugedacht ist, nicht thematisieren will, wer die Regeln der herrschenden Reichtumsproduktion und deren politische Verwaltung als alternativlos voraussetzt und die damit einhergehenden sowohl persönlichen als auch gesellschaftlichen Kollateralschäden als ebenso alternativlos und deshalb hinzunehmend behauptet, braucht sich nicht zu wundern, wenn sich die von ihren unverstandenen Voraussetzungen herrührende Unzufriedenheit der Bürger in genau jenen Bahnen Raum und Ausdruck verschafft, die im demokratisch-kapitalistischen Gesellschaftswesen von Grund auf angelegt sind: nämlich in einem nationalistisch unterfütterten Anspruchsverhalten und einem sich auf dieser Grundlage radikalisierenden Aus- und Abgrenzungswahn, der sich notwendig gegen Fremde(s) und Unangepasste(s) als Ersatzschuldige wenden muss, weil die Grundkostanten des demokratisch-kapitalistischen Gesellschaftsganzen (Kapital, Lohnarbeit, Konkurrenz, Delegation und Ausschluss von der Macht durch Wahlen) als die Verursacher ihres Unbehagens grundsätzlich weder zur Diskussion noch zur Disposition stehen sollen und dürfen.
Die begriffsleere Entrüstung der Bürger über die ihnen demokratisch aufgehalsten Zumutungen, deren schicksalshafter Fortgang ihnen ausgerechnet mittels freien Wahlentscheidungen als ihr ganz persönliches Anliegen wieder und wieder schmackhaft gemacht werden soll, gebiert notwendigerweise die immer gleichen, wenn auch immer rabiater sich gebärdenden nationalistischen Gespenster. Von ihnen erwarten sich die Enttäuschten und Frustrierten Erlösung und erhalten stattdessen ein vergiftetes Mahl untergeschoben, dessen am Ende tödliche Konsequenzen sie sich lieber nicht auszumalen getrauen!