Der Preis der repräsentativen Demokratie: Staatsschulden ohne Ende
17.03.2014 - Wolfgang J. Koschnick
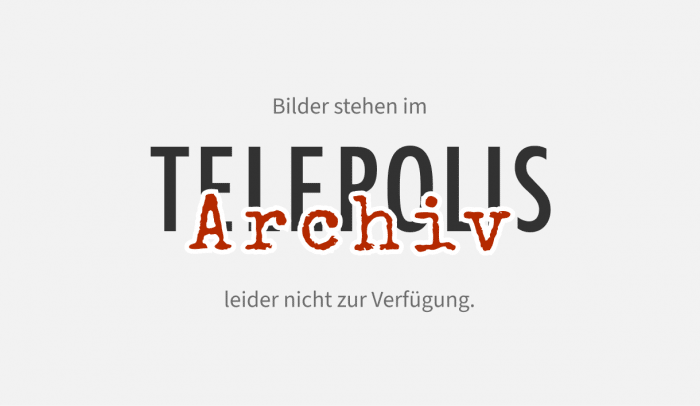
Ursprüngliches Bild: Bild: Tull, Christoph: Die dynamischen Wirkungen der Staatsverschuldung und ihre Konsequenzen
Eine Demokratie haben wir schon lange nicht mehr - Teil 16
Das Überleben aller entwickelten Demokratien von den USA über Westeuropa bis hin nach Japan ist bedroht. Die weitaus meisten dieser existenzbedrohenden Herausforderungen wurden überhaupt erst durch das System der repräsentativen Demokratie erzeugt. Die größte existenzielle Krise ist die totale Verschuldung der Staaten. Sie ist eine Kreatur der repräsentativen Demokratien. Nur die repräsentativen Demokratien sind so grenzenlos verschuldet. Aber sie sind es so gut wie alle. Das muss man sich sorgsam vor Augen führen: Wir haben es nicht nur mit Misswirtschaft und Korruption zu tun. Es sind die Systeme der entwickelten repräsentativen Demokratien, die sich selbst und damit auch ihre Völker in den Abgrund führen.
Alle entwickelten Demokratien von den USA über Westeuropa bis hin nach Japan stehen am Rande des Kollapses. Die Verschuldung ihrer öffentlichen Institutionen hat längst existenzbedrohende Dimensionen angenommen.
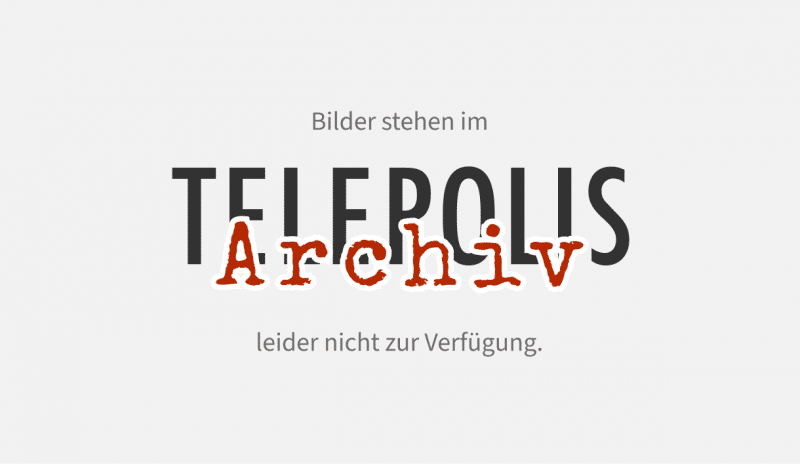
Viele entwickelte Demokratien stehen kurz vor dem Staatsbankrott, allen voran die USA. Dort kann man das am besten verfolgen. Alle paar Monate droht der totale Zusammenbruch, der "shutdown", die Zahlungsunfähigkeit der öffentlichen Hand. Und jedes Mal findet die Politik dieselbe zweifelhafte "Lösung" des Problems: Man erhöht einfach die Obergrenze für die Verschuldung des Staats, um den drohenden Staatsbankrott abzuwenden, und wurstelt dann so weiter wie bisher.
2013 wurde die Schuldenobergrenze wieder einmal - diesmal auf 17 Billionen Dollar - angehoben. Aber ewig geht das nicht weiter. Irgendwann kommt der Punkt, an dem eine weitere Erhöhung der Schuldenobergrenze wirtschaftlich nicht mehr zu verkraften sein wird.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit stand eine politische Ordnung auf Grund ihres systemimmanenten Zwangs zur Selbstzerstörung so nahe und schon so lange am Rande des Abgrunds. Und es ist durchaus möglich - sogar ziemlich wahrscheinlich -, dass die Vielzahl der Krisen mit dem Untergang des Systems der repräsentativen Demokratie endet.
Es gilt zu prüfen, ob Demokratien in der Lage sind, ihre selbst geschaffenen Existenzkrisen zu bewältigen, ob sie überhaupt in der Lage sind, mit größeren Herausforderungen fertig zu werden oder ob es systemimmanente Hindernisse gibt, an denen ihre Bewältigung scheitern muss.
Die bei weitem größte existenzielle Krise der entwickelten Demokratien ist die totale Verschuldung der Staaten. Sie ist eine Kreatur der repräsentativen Demokratien. Nur die repräsentativen Demokratien sind so grenzenlos verschuldet. Aber sie sind es so gut wie alle. Es fragt sich, ob sie das wieder zurückdrehen können.
Die Verschuldung der demokratischen Staaten ist systemimmanent
Genauer genommen fragt sich, ob die Verschuldung der demokratischen Staaten systemimmanent ist oder nicht? Denn es ist schon merkwürdig: Von den zehn oder zwanzig am stärksten verschuldeten Staaten der Welt sind alle entwickelte repräsentative Demokratien. Das kann man nicht bagatellisieren und als einen absonderlichen Zufall bezeichnen.
Es gibt offensichtlich einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Hang öffentlicher Institutionen, sich permanent und unbremsbar zu verschulden, und dem System der repräsentativen Demokratie. Und die bis an den Rand des Zusammenbruchs führende Verschuldung aller öffentlichen Hände ist der Preis, den die Völker für die Bequemlichkeiten der repräsentativen Demokratien zahlen. Alles deutet darauf hin, dass dieser Preis viel zu hoch ist.
In den 64 Jahren von 1950 bis heute ist die Staatsverschuldung in Deutschland jedes Jahr gestiegen. Kein einziges Mal ist sie - und sei es nur ein wenig, um wenigstens die Unkenrufer Lügen zu strafen - gesunken.
Sie stieg von bescheidenen (umgerechnet) 10 Milliarden Euro auf zwei Billionen und 72 Milliarden Euro (im IV. Quartal 2012). Sie stieg übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in allen anderen entwickelten demokratischen Staaten. Das spricht sehr dafür, dass die über viele Jahrzehnte wachsende Staatsverschuldung systembedingt ist.
Staatsverschuldung ist nicht grundsätzlich und unter allen Umständen etwas Schlechtes. Wenn ein Staat einen Überschuss erwirtschaftet und spart, kann er ihn später in einer Rezession wieder sinnvoll einsetzen, um die Konjunktur zu beleben. Durch "deficit spending" können so Flauten überwunden werden. So die Theorie.
Allerdings besteht in der Praxis die Gefahr, dass in der Rezession zwar die Staatsverschuldung steigt, aber bei Belebung der Konjunktur nicht wieder abgebaut wird.
Dies ist nicht bloß eine Gefahr, die eintreten oder auch nicht eintreten kann - wie ein plötzliches Unwetter. Sie gehört zur Realität der entwickelten repräsentativen Demokratien in aller Welt, weil die Repräsentanten in ihrer gnadenlosen Verantwortungslosigkeit alle Gelder mit vollen Händen auszugeben pflegen, derer sie habhaft werden.
Genauer gesagt, ist diese Gefahr nicht einfach nur ziemlich groß. Sie ist allgegenwärtig. Die Repräsentanten stehen stets mehr oder weniger kurz vor einer Wahl. Und deshalb streuen sie ständig Wahlgeschenke unters Volk.
In Wahrheit war das "deficit spending" immer nur eine schöne, ziemlich einleuchtende Theorie für die volkswirtschaftlichen Lehrbücher. In der Praxis hat es jedoch so gut wie nie funktioniert, weil ein an sich vernünftiges konjunkturpolitisches Instrument in den Händen von unvernünftigen Politikern einer repräsentativen Demokratie nichts taugen kann.
Wenn ein Staat jedoch den Schuldenberg zu jeder Zeit wachsen lässt, egal ob im Wirtschaftsboom oder in der Rezession, zerstört er selbst dieses Instrument der Konjunkturpolitik und diesen Staat auf Dauer gleich mit. Und das haben praktisch alle entwickelten demokratischen Industrienationen geschafft.
In den meisten Demokratien ist die Verschuldung der öffentlichen Haushalte in gut einem halben Jahrhundert ohne Sinn und Verstand in astronomische Höhen getrieben worden. Und die Demokratien sind damit immer handlungsunfähiger und zum Spielball der Finanzmärkte geworden.
Fritz Schäffer (CSU), der erste Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, war der Einzige, der es in seiner Amtszeit von 1949 bis 1957 schaffte, einen Überschuss zu erwirtschaften. Natürlich kam Schäffer zugute, dass die Währungsreform 1948 Westdeutschland einen fiskalischen Neustart beschert hatte.
Das alte Geld war kaum noch etwas wert: Die Voraussetzungen waren günstig, solide zu wirtschaften. Die Demokratie in Deutschland war noch jung, man nahm die Verantwortung noch ernst. Das ist über ein halbes Jahrhundert her. Alle anderen Bundesregierungen und ihre Finanzminister lebten und leben noch immer auf Pump.
Sechs Finanzminister später hatten sich der Zeitgeist und die Zahlungsmoral radikal geändert. Die Wirtschaft florierte. Es gab mehr Arbeit als Kräfte, in der sozial-liberalen Koalition schien alles finanzierbar.
Zwei Finanzminister, Alex Möller (SPD) und sein Nachfolger Karl Schiller, traten 1971 und 1972 zurück, weil sie die leichtfertige Ausgabenpolitik der sozialliberalen Regierung nicht verantworten wollten.
Mit einer Haushaltslücke von über vier Milliarden Mark für das Jahr 1971 (bei einem Haushaltsvolumen von 100 Milliarden) und von etwa zehn Milliarden Mark für 1972 könne er nicht mehr Bundesfinanzminister bleiben, erklärte Möller und gab das Amt an Karl Schiller weiter.
Er sei nicht bereit, eine Politik zu unterstützen, sagte Schiller, "die nach außen den Eindruck erweckt, die Regierung lebe nach dem Motto: Nach uns die Sintflut".
Danach ging es mit den Schulden nur noch steiler aufwärts. Auch Schiller trat schließlich unter Protest zurück. Sein Nachfolger hatte noch viel weniger Skrupel bei der Schuldenaufnahme. Der hieß Helmut Schmidt, machte zehn Milliarden Mark neue Schulden - und wurde zwei Jahre später Kanzler.
Dabei stand der Aufbruch ins Uferlose überhaupt erst noch bevor. Die Konjunktur trübte sich ein, vor allem nach den Ölpreisschocks von 1973 und 1979, die Zahl der Arbeitslosen stieg kontinuierlich.
Doch die Regierung unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) tat unverdrossen weiter so, als befände sich Deutschland noch immer im Wirtschaftswunder: Sie gab bei weitem mehr aus, als sie einnahm. Unter der Kanzlerschaft des großen Staatsmanns Helmut Schmidt wuchs die Verschuldung des Bunds von 39 Milliarden auf 160 Milliarden Euro. 1982 zerbrach die sozial-liberale Koalition auch daran.
Doch das sind Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Heute würde kein Finanzminister mehr zurücktreten, nur weil er einen Haushalt versaubeutelt hat. Selbst als 2010 die Haushaltslücke über 80 Milliarden Euro betrug und durch Neuverschuldung gedeckt werden musste, sah sich der Finanzminister nicht veranlasst zurückzutreten. Das ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der politischen Folklore geworden. Niemand fand, er sollte zurücktreten, noch nicht einmal die Opposition.
Früher hatte die Kreditaufnahme den Sinn, temporäre Engpässe zu überwinden, Zeit gewinnen und eventuell auch noch die Wirtschaft anzukurbeln. Das gehört in die sagenumwobene graue Vorzeit der Schuldenaufnahme.
Heute machen die Staaten neue Schulden, um die Zinsen für alte Schulden zu bezahlen
Bis in die 1980er Jahre hinein machte der Staat neue Schulden, um Straßen, Autobahnen, KrankenXhäuser und AltersXheime zu bauen. Heute macht er im Wesentlichen neue Schulden, um die Zinsen für die alten Schulden zu bezahlen. Die Neuverschuldung dient nur noch dazu, sich von einem Krisenjahr ins nächste Krisenjahr zu hangeln. Allerdings ohne die geringste Aussicht darauf, dass sich im nächsten Jahr das Blatt zum Guten wendet.
Alle Bürger bürgen für die Schulden ihres Staates. Folglich sind gegenwärtige Schulden eines Staates auf Grund der Tilgungspflicht und der Zinszahlungspflicht künftig zu zahlende Steuern. Die Schulden werden also langfristig von mehreren Generationen in Form von Steuern gezahlt.
Wie gewaltig der objektive Zwang zur finanzpolitischen Kurzatmigkeit ist, zeigt das dramatische Anwachsen der Staatsverschuldung seit 1969. Egal, welche politische Partei(en) gerade regierte(n): Stets wuchs mit einer wachsenden Zahl von Wahlgeschenken die Staatsverschuldung.
Schuldenkanzler war jeder Kanzler schon mal
Es war auch völlig egal, wie erbittert sich die Parteien in der Öffentlichkeit als knallharte Sparkommissare zu profilieren versuchten oder die jeweilige Gegenseite im Brustton der Überzeugung als "Schuldenpartei" oder gar als "Kanzler der Schulden" beschimpften: Da wurde bisher noch keiner verschont: Schuldenkanzler Willy Brandt, Schuldenkanzler Helmut Schmidt, Schuldenkanzler Helmut Kohl, Schuldenkanzler Gerhard Schröder und Schuldenkanzlerin Angela Merkel… jeder hat da bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit schon sein Fett wegbekommen.
Die meisten Finanzminister, die in der Regel mit dem hehren Vorsatz ihr Amt antraten, die Verschuldung oder wenigstens die Neuverschuldung drastisch zu senken, standen am Ende ihrer Amtszeit ebenso als Schuldenmacher da wie alle anderen vor ihnen und alle anderen nach ihnen. Und jeder hatte den Titel auch verdient. Nur: Keiner von denen, die da laut über die anderen schimpften, hatte das Recht, aus seinem eigenen Glashaus heraus mit Steinen zu werfen.
Am Ende wuchs in den meisten demokratisch regierten Ländern der Welt stets die Staatsverschuldung. Von den USA über Europa und bis nach Japan sind die meisten entwickelten demokratischen Staaten bis über beide Ohren verschuldet. Und daran lässt sich leicht erkennen, dass es sich um einen fundamentalen Strukturfehler der repräsentativen Demokratien handelt. Länder wie Italien und Japan oder Frankreich und die USA haben sonst nur wenige kulturelle, soziale und politische Gemeinsamkeiten - außer eben, dass sie demokratische Systeme und über alle Maßen verschuldet sind.
Die jahrzehntelang wachsende Staatsverschuldung ist ein Phänomen entwickelter demokratischer Staaten. Das schließt nicht aus, dass der eine oder andere nichtdemokratische Staat sich auch verschuldet. Aber eine hohe Staatsverschuldung gehört nicht zu ihren konstituierenden Merkmalen. Dagegen ist die Mehrheit der entwickelten Demokratien systembedingt durchweg hochverschuldet.
Die Gesamtschulden aller öffentlichen Haushalte in Deutschland betragen 2,072 Billionen Euro (Stand Ende 2013). In der Praxis ist ein Haushaltsüberschuss in der Bundesrepublik seit den 1950er Jahren nicht mehr vorgekommen.
Die zur Bedienung der öffentlichen Schulden notwendigen Zinsausgaben waren 2011 sogar der zweitgrößte Posten der Bundesausgaben. Nur für Arbeit und Soziales wird noch mehr Geld ausgegeben. Nicht einmal die Verteidigung kostet so viel wie der Schuldendienst.
Allein der Bund hat in den vergangenen 40 Jahren einen Schuldenberg von 1,3 Billionen Euro angehäuft. Dafür werden rund 40 Milliarden Euro an Zinsen fällig. Jeder sechste Euro der Steuereinnahmen des Bundes floss 2011 direkt in den Schuldendienst. Das muss man sich in aller Dramatik vor Augen führen: Mit den Beträgen, die allein der Bund in Deutschland für Zinsen zahlt, kann man eine ganze moderne Armee unterhalten. Pro Sekunde erhöht sich die deutsche Staatsschuld um 1.556 Euro.
Von 1965 bis 2010 betrug auf der Ebene des öffentlichen Gesamthaushalts die Summe aller Neuverschuldungen beziehungsweise Defizite 1,480 Billionen Euro und die Summe aller Zinsausgaben 1,642 Billionen Euro. Die Blöcke Kreditaufnahmen und Schuldendienst halten sich also im langfristigen Mittel die Waage. Die Neuverschuldung dient im Wesentlichen dazu, die alten Schulden zu bezahlen. Ein ökonomischer Aberwitz: Man nimmt Kredite auf, um Schulden zu zahlen.
Die Rückzahlung der jeweils neuen Kredite samt Zinsen und Zinseszinsen wird in eine ferne Zukunft verschoben: Ein ewiger Kreislauf der Umschuldung. Es ist das klassische Schneeballsystem, wie es sonst Anlagebetrüger praktizieren. Dabei kommen Schneebälle ins Rollen, die immer größer und immer mächtiger werden, bis eine Lawine entsteht, die alles mit sich reißt.
Allein im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts haben die demokratischen Staaten ihre Gesamtverschuldung mehr als verdoppelt, auf über 55 Billionen Euro. Und das war immerhin das Jahrzehnt der großen Sparanstrengungen.
Doch die Spirale dreht sich allen ebenso hehren wie leeren Versprechungen der Politiker zum Trotz unablässig und unaufhaltsam immer weiter und immer weiter. 2011 kam es zu einer historischen Sensation: Erstmals seit über einem halben Jahrhundert sank die Neuverschuldung des Bundes, und zwar beachtlich von 80,2 Milliarden im Jahr 2010 auf nur noch 22 Milliarden Euro. Grund zum Jubeln? War damit nicht doch der Nachweis erbracht, dass konsequente Haushaltspolitik die ständig wachsende Verschuldung ausbremsen kann?
Denkste.
Mit erbitterten Sparanstrengungen und einer gezielten Haushaltspolitik hatte das nicht das Geringste zu tun. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief gerade recht günstig, die Arbeitslosenzahlen gingen zurück, die Steuereinnahmen sprudelten. 2011 erzielte Deutschland das höchste Wirtschaftswachstum seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosigkeit war so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die sozialen Sicherungssysteme schwammen im Geld.
Der Geldsegen zwang die Rentenversicherung gar, ihren Beitragssatz zu senken, die Arbeitslosenversicherung schlug Hilfskredite des Bunds aus, im Gesundheitssystem sammelten sich Reserven von 16 Milliarden Euro, und sogar die Pflegeversicherung schloss wider Erwarten ohne Defizit ab. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hatte der Staat mehr eingenommen als 2011.
Das erklärt auch, warum alle Politiker alle Hoffnungen stets auf das Wirtschaftswachstum setzen. Wenn die Wirtschaft wächst, besteht Aussicht auf höhere Einnahmen. Dass sie das durch eine vernünftige ökonomische Planung nicht hinkriegen, ist ihnen auch längst bewusst. Der Wachstumsfetischismus der demokratischen Politik hat noch eine ganz andere Ursache: Sie sind entschlossen, die Staatsausgaben weiter zu steigern.
Nur eine Scheinlösung: Wirtschaftswachstum um jeden Preis
Die Obergrenze für weitere Kreditaufnahmen ist längst erreicht, wenn nicht überschritten. Folglich haben sie nur noch eine einzige Hoffnung, ihre Macht durch weitere Ausgaben zu erhalten und zu stabilisieren: Die Wirtschaft muss wachsen. Da können all die braven Anhänger nachhaltigen und umweltschonenden Wirtschaftens so viel schwärmen wie sie mögen. Das schert die demokratischen Politiker einen feuchten Kehricht. Sie brauchen brutales Wirtschaftswachstum um jeden Preis, um wenigstens die nächsten paar Jahre zu überleben.
Der Geldsegen von 2011 war halt ein unverhoffter Glücksfall, sonst gar nichts. Die Politik hatte nicht den geringsten Anteil daran. Ja, die Bundesregierung rühmte sich sogar, sie habe ja ursprünglich eine viel höhere Neukreditaufnahme von 48,4 Milliarden Euro geplant. Hatte sie in der Tat. Doch selbst dafür konnte sie nichts. Das zusätzliche Geld war - wie gesagt - ganz unerwartet hereingesprudelt…
Deshalb stieg die Neuverschuldung auch im nächsten Jahr, 2012, auch gleich wieder auf 26,1 Milliarden Euro an. Weil er 2011 - im Boomjahr - nicht genügend gespart hatte, musste der Bund schon 2012 wieder mehr Kredite aufnehmen. Die sich selbst als fiskalisches Vorbild für Europa preisende Bundesrepublik blähte ihr Defizit inmitten der schlimmsten Schuldenkrise seit den dreißiger Jahren wieder deutlich auf.
Die Konjunktur hatte sich wieder abgeschwächt, zusätzliche Risiken waren durch die Euro-Schuldenkrise und durch die ausgabensteigernden Beschlüsse der Koalition entstanden - darunter Verkehrsinvestitionen und zusätzliche Ausgaben für das Weihnachtsgeld für Beamte.
Im Oktober 2011 hatte die Koalition die Rückkehr zum vollen Weihnachtsgeld für Beamte des Bundes beschlossen. Und das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause selbst erziehen und dafür keine Kindertagesstätten in Anspruch nehmen, schlägt mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr zu Buche.
Das Geld wird wieder wie bisher zum Fenster hinausgeworfen. Das mit Getöse verkündete Ziel, den Haushalt nachhaltig und dauerhaft zu konsolidieren, hat die Bundesregierung bereits wieder aufgegeben, bevor die Verkündigung richtig verhallt war.
Um die Schuldenquote von derzeit 83 Prozent des Bruttoinlandsprodukte (BIP) innerhalb einer vernünftigen Frist auf die vorgeschriebenen 60 Prozent zu senken, reicht ein gerade mal ausgeglichener Haushalt sowieso nicht aus. Dazu braucht man Etatüberschüsse. Doch die bleiben aus.
Um Überschüsse zu erzielen, braucht ein Haushalt einen positiven Primärsaldo. Das ist die Differenz von Staatseinnahmen ohne Neuverschuldung und Staatsausgaben ohne Kosten für Zinsen und Zinseszinsen. Ist dieser Saldo im Plus, kann ein Land seine laufenden Ausgaben decken und wenigstens einen Teil seiner Schulden zahlen. Ist er im Minus, muss das Land seine alten Schulden vollständig durch Aufnahme neuer Kredite bedienen. Und wenn das geschieht, wächst der Schuldenberg rasant.
Vor allem die Erhöhung des Weihnachtsgelds für Beamte auf dem Höhepunkt der europäischen Staatsschuldenkrise zeigt, dass alle politischen Parteien mittlerweile zu Klienteleparteien verkommen sind. Es ist ihnen wesentlich wichtiger, ihre diversen Klienteles zufrieden zu stellen, als etwa verantwortungsbewusste Haushaltspolitik zu treiben.
Primäres Ziel aller Haushaltsentscheidungen ist und bleibt der Machterhalt der eigenen Parteien - nicht eine vernünftige Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Und solange sich daran nichts ändert - und in repräsentativen Demokratien kann sich allein mit gutem Willen nach dem Motto "ab morgen wird gespart" niemals etwas ändern -, dreht sich die Verschuldungsspirale immer weiter und immer weiter.
Im Boomjahr 2010 wäre es möglich gewesen, die als Konjunkturpaket verteilten Milliarden wieder einzusparen. Doch das großmäulig angekündigte Sparvorhaben der Koalition verpuffte - so wie immer. Auch das ist eine Konstante demokratischer Politik: Mit großspurigen Ankündigungen kommt man in die Medien und kriegt eine wohlwollende Presse. Was man dann anschließend in der wirklichen Wirklichkeit tut, ist nicht so wichtig. Damit beschäftigt sich sowieso kaum noch jemand.
Die mittelfristige Etatplanung steckte ohnehin voller Finanzlöcher und Risiken und wurde nun durch Steuersenkungen, Betreuungsgeld und Pflege-Riester zusätzlich belastet. Aufgabe der Bundesregierung wäre es gewesen, in der Zeit des konjunkturellen Booms einen radikalen Sparkurs vorzulegen. Doch sie ließ die Gelegenheit wie so viele andere ungenutzt verstreichen.
Das Defizit wächst also wieder wie in all den Jahrzehnten zuvor. Statt den Bundeshaushalt zu konsolidieren, zeigt sich die Bundesregierung grimmig entschlossen, auch in Zukunft so weiterzuwursteln wie schon immer. Trotz der zurzeit hohen Steuereinnahmen steckt sie die Mehreinnahmen - wie in der Vergangenheit - sogleich in neue Ausgabenprogramme.
Dem eigenen Anspruch, alle staatlich übernommenen Aufgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen, wird die Regierung noch nicht einmal im Ansatz gerecht. Allen vollmundigen Ankündigungen zum Trotz wird auch die derzeit herrschende große Koalition aus CDU/CSU und SPD die Politik der verantwortungslosen Verschuldung ohne Bedenken fortsetzen. Schon jetzt ist erkennbar, dass sie die Bürger mit Rentengeschenken und heimlichen Steuererhöhungen wie kaum eine Regierung vor ihr weiter schröpfen wird. Bis 2017 wird die Belastung um gut 100 Milliarden Euro steigen.
Das ist übrigens völlig unabhängig davon, welche Parteien gerade die Regierung bilden. Kommen andere Parteien an die Regierung, geht es mit der Neuverschuldung dennoch weiter. Ein überdeutliches Indiz dafür, dass die Verschuldungsversessenheit der Politiker ein parteienübergreifendes, systembedingtes Strukturproblem der Demokratien ist.
Der Beschluss zur erneuten Erhöhung der Neuverschuldung fiel auf dem Höhepunkt der europäischen Staatsschuldenkrise, als die Bundesrepublik harsche Kritik an total überschuldeten Ländern wie Griechenland, Irland, Portugal, Italien und Spanien übte und sich zum obersten Sparkommissar Europas aufschwang. Dabei wird gern verdrängt, dass auch Deutschland gnadenlos verschuldet ist.
Doch bis dahin hatte die Bundesregierung dennoch eine gewisse Legitimation, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und ihnen extreme Sparanstrengungen abzuverlangen. Aber wie will man das jetzt noch rechtfertigen, nachdem die Bundesregierung im eigenen Land ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat?
Man tröstet sich in der deutschen Politik allen Ernstes damit, dass die Verschuldung noch nicht das Ausmaß wie in Griechenland, Portugal, Spanien, Italien oder auch in Japan oder gar den USA erreicht hat, wo alle paar Monate der totale Stillstand droht, nur weil bis in die letzte Minute hinein ungewiss ist, ob die Gehälter der Beamten und öffentlichen Angestellten noch gezahlt werden können. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Laurence Kotlikoff meint gar:
Die Vereinigten Staaten sind vermutlich in einer schlechteren fiskalischen Verfassung als Griechenland.
Aber das bedeutet ja nun nicht, dass die Last der Schulden des Bundes, der Bundesländer und der Städte und Gemeinden hierzulande nicht an der Grenze dessen stünde, was überhaupt noch zu verkraften ist. Denn in Wirklichkeit ist die Lage in Deutschland höchst bedrohlich. So liegt die Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei 83 Prozent. Und in der Europäischen Union ist das alles andere als vorbildlich. Es ist gerade mal durchschnittlich. Selbst der "Schuldenstaat" Spanien schneidet mit 73,8 Prozent ein gutes Stück besser ab.
Doch um den Schuldenstand innerhalb von zehn Jahren auf 60 Prozent zu drücken, bräuchte Deutschland dauerhaft jedes Jahr mindestens einen Primärüberschuss von zwei bis drei Prozent. Und um das Ziel in nur fünf Jahren zu erreichen, bräuchte man einen Primärüberschuss von rund fünf Prozent. Deutschland hat derzeit aber gerade mal ein Prozent. Die selbstgesetzten Ziele sind also viel zu weit von allem entfernt, was in der Realität je zu erreichen wäre. Sie sind weltfremd.
Die einzige Form von Haushaltsplanung, die Deutschland betreibt, ist vom "Prinzip Hoffnung" getrieben: Hoffnung auf künftiges Wirtschaftswachstum.
Alle optimistischen Kalkulationen der Bundesregierung brechen in sich zusammen, wenn die wirtschaftliche Wirklichkeit sich nicht an die frohe Prognose künftigen Wachstums hält. Und das hat die Wirklichkeit nun mal so an sich. Sie schert sich nicht im Geringsten um die schönen Prognosen. Das Prinzip Hoffnung ist kein Planungsinstrument, sondern nicht mehr als einfältiger Zweckoptimismus.